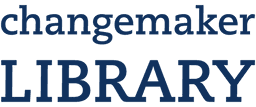Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Amalia FischerBrasilien • Ashoka-Fellow seit 2003
Amalia E. Fischer gründete den ersten Frauenfonds in Brasilien zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Durch den Fonds schärft Amalia das Bewusstsein für die Beiträge und Probleme von Frauen und verändert gleichzeitig die Muster traditioneller philanthropischer Spenden.
Die Person
Amalia wurde in Managua geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit zwischen der Farm ihrer Großmutter mütterlicherseits im ländlichen Nicaragua und dem Haus ihrer Großmutter väterlicherseits in Mexiko. Die Mutter ihrer Mutter war die erste Lehrerin in Nicaragua und brachte Amalia bei, zu lesen und das Land zu lieben. Amalia lernte Gärtnern und pflückte im Sommer Baumwolle. Die Mutter ihres Vaters inspirierte sie zum Lernen und machte sie zu einer Liebhaberin von Geschichten, indigener Kultur, Poesie und dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Amalias Eltern unterstützten und ermutigten die Ausbildung ihrer Kinder und halfen sogar Amalias Bruder, im Ausland zu studieren. Aber als Amalia zu ihrem Vater ging, um ihr vorzuschlagen, dasselbe zu tun, sah er die Bedeutung nicht ein, da ihre Aussichten auf eine Karriere nicht bedeutend waren. Sie gab nicht nach und bat ihre Mutter um Unterstützung und überzeugte ihn schließlich, ihr zu helfen, das Geld für ein einjähriges Studium in Belgien aufzutreiben. Dort lernte sie eine Welt der Kultur, Kunst und Information kennen und engagierte sich schnell für Frauenorganisationen, die sich aus lateinamerikanischen feministischen Führern zusammensetzten. Sie war in Paris, als der Krieg in ihrem Heimatland begann. Einige ihrer Freunde und Kollegen aus den christlichen Gruppen, an denen sie teilgenommen hatte, versuchten sie davon zu überzeugen, wieder für die sandanistische Regierung zu kämpfen. Aber obwohl sie mit vielen Idealen der Bewegung sympathisierte, waren Amalias eigene Ideale auf Gewaltlosigkeit fixiert. Inspiriert von Martin Luther King und als Befürworterin von Demokratie, Gleichheit und Inklusion würde sie sich nicht an gewalttätigen Aktionen für die Sache der Sandinisten beteiligen. Als sie Europa verließ, beschloss sie, nicht in ihrem vom Krieg heimgesuchten Land zu leben, und kehrte stattdessen in das Haus ihrer Großmutter in Mexiko zurück. In Mexiko setzte Amalia ihr Studium fort und wurde im Alter von 21 Jahren Professorin für politische Soziologie an der Autonomous University of Mexico. An der Universität konzentrierte sie sich weiterhin auf die Gleichstellung der Geschlechter und war Mitbegründerin des Center for Women's Studies und des Center for Research and Kapazitätsaufbau für Frauen. Als Amalia ihre Aktivitäten in der feministischen Bewegung verstärkte, erkannte sie, dass es ohne Ressourcen schwierig war, die Bedingungen der Ungleichheit, die Frauen erfahren, zu verändern. Sie ließ sich von zwei Beispielen in Mexiko inspirieren: Semillas, ein Fonds für Ressourcen für Frauen, und das mexikanische Zentrum für Philanthropie. Ihre andere Inspiration kam von zwei Frauenfonds aus dem Norden: Mama Cash in Holland, die viele ihrer Forschungen zum Feminismus in Lateinamerika finanzierte, und dem Global Fund for Women in den USA. 1996 lud Mama Cash Amalia ein, ihre Repräsentantin in Brasilien zu sein. Besorgt darüber, diese Rolle als Ausländerin zu übernehmen, beriet sie sich mit brasilianischen Kolleginnen der feministischen Bewegung und erzählte ihnen von ihrer Idee, einen Fonds für Frauen in Brasilien zu gründen. Die enthusiastische Reaktion und das Unterstützungsangebot überzeugten sie davon, dass der Moment richtig war, und sie begann, die Gründung des Angela-Borba-Fonds zu entwerfen und auszuhandeln, ein Name, der zu Ehren einer Anführerin im Kampf für die Rechte der Frau gewählt wurde Redemokratisierung in Brasilien.
Die neue Idee
Amalia hat einen auf Vielfalt ausgerichteten Mechanismus für soziale Investitionen in Brasilien geschaffen – einen, der die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau in den Mittelpunkt einer neuen Philanthropie stellt. Sie gründete den Angela Borba Fund, um gezielt in unabhängige Projekte von und für Frauen zu investieren. Der Fonds verfolgt einen wegweisenden Ansatz für soziale Investitionen und ist eine der wenigen Organisationen im Land, die im Gegensatz zu Unternehmensstiftungen und Förderinstitutionen, die ihre eigenen Sozialprogramme erstellen und verwalten, Mittel aufbringen, um sie in bestehende, unabhängige Programme umzuleiten. Amalia arbeitet daran, die Kultur der Philanthropie und der sozialen Investitionspraktiken in Brasilien zu modernisieren, indem sie eine Kampagne startet, an der Unternehmen, Institute und einzelne Spender teilnehmen. Ihr Ziel ist es, die „Hand-out“-Mentalität der Menschen beim Geben in ein tieferes Verständnis dafür zu verwandeln, wie wichtig es ist, sozial in Vielfalt zu investieren und Geschlechterverhältnisse zu verändern. Ihre Botschaft behauptet, dass gut platzierte Investitionen in die sozioökonomische, kulturelle und technologische Stärkung von Frauen hohe Renditen in Bezug auf die Investitionen dieser Frauen in Kinder, Jugendliche und die Gesellschaft als Ganzes generieren.
Das Problem
Trotz vieler Fortschritte bei der Anerkennung der Frauenrechte in Brasilien sind Frauen aufgrund ihres Geschlechts weiterhin Diskriminierung, Ungleichheit, Gewalt und Chancenlosigkeit ausgesetzt. Diese Realität wirkt sich direkt auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes aus, wenn man bedenkt, welche wichtige Rolle Frauen sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz spielen und weiterhin spielen. Fast 25 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind Haushaltsvorstände – das entspricht 11,2 Millionen Frauen, die allein für ihre Familien sorgen. Obwohl sich der Abstand zwischen den Gehältern von Männern und Frauen etwas verringert hat, verdienen Frauen im gleichen Beruf immer noch 30 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Gewalt gegen Frauen ist eine versteckte und normalisierte Praxis; Schätzungen der Abramo Foundation zufolge werden 6,8 Millionen brasilianische Frauen regelmäßig geschlagen. Die Situation für farbige Frauen ist ernster; fehlender zugang zu bildungs- und berufsmöglichkeiten bedeutet prekäre lebensverhältnisse für diese frauen und ihre familien. Unter den erwerbstätigen schwarzen Frauen ist die überwiegende Mehrheit körperlich tätig, 51 Prozent arbeiten als Hausangestellte. Das Durchschnittsgehalt weißer Frauen ist fast dreimal so hoch wie das Durchschnittsgehalt schwarzer Frauen, die weniger als 80 US-Dollar pro Monat verdienen. In den letzten 15 Jahren haben Frauen in Brasilien Organisationen gegründet, die sich neben der Gleichstellung der Geschlechter und den Menschenrechten von Frauen mit Themen wie Beschäftigung, Gewalt, Berufsausbildung und Gesundheit befassen. Diese Organisationen haben ihre Arbeit weitgehend durch die Unterstützung internationaler Finanzierungsagenturen und -organisationen durchgeführt. Viele Frauenorganisationen durchleben jedoch eine Wirtschaftskrise angesichts der Reduzierung der internationalen Unterstützung für Brasilien, des Mangels an Know-how bei der Mittelbeschaffung und Ressourcenmobilisierung sowie des mangelnden Interesses nationaler Unternehmen und Stiftungen, in Gender- und Genderfragen zu investieren Frauenrechte. Derzeit berichten Frauenorganisationen, dass nur 10 Prozent der Programmfinanzierung von brasilianischen Unternehmen stammt. In einer 2000 von der IPEA in der auf Unternehmen konzentrierten südöstlichen Region Brasiliens durchgeführten Studie über „Social Action of Companies“ (Soziale Maßnahmen von Unternehmen) wurde das Geschlechterverhältnis nicht auf die Prioritätenliste des Privatsektors gesetzt. Nur 7 Prozent der Unternehmen unterstützen von Frauen gefördertes soziales Handeln. Mehrere Faktoren tragen zum Mangel an Investitionen in Frauenorganisationen und -programme bei, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter befassen. Die brasilianische Gesellschaft muss noch erkennen, wie wichtig es ist, in Frauen zu investieren, sowohl als eine Form der Förderung der Gleichberechtigung als auch als Strategie für sozialen Wandel und sozioökonomische Entwicklung. Als Konsumentinnen beeinflussen Frauen den Kauf von Lebensmitteln sowie Haushaltsreinigungs- und Hygieneprodukten zu nahezu 100 Prozent. Sie halten über 40 Prozent der Titel an Giro- und Sparkonten bei den beiden brasilianischen Bundesbanken Banco do Brasil und Caixa Economico. Trotz dieser aktiven Verbraucherrolle versäumen es die Praktiken der Unternehmensphilanthropie, die Bedeutung von Frauen in der Wirtschaft zu berücksichtigen. Neben einem mangelnden Verständnis für die Rolle von Frauen in der Wirtschaft mangelt es auch an Sichtbarkeit und Verbreitung erfolgreicher Programme und Projekte des sozialen Wandels, die für und von Frauen konzipiert und durchgeführt werden. Darüber hinaus bestehen viele Missverständnisse über Frauengruppen. Unternehmen und Förderinstitutionen neigen dazu, Frauenorganisationen als exklusiv, männerfeindlich und radikal wahrzunehmen, was ihren Investitionswillen hemmt. Ironischerweise zeigt innerhalb dieses nationalen Bildes eine Studie aus dem Jahr 2000 "Spenden und Freiwilligenarbeit" (Landim und Scalon), dass 60,1 Prozent aller Arten von Spenden durch Institutionen in Brasilien von Frauen geleistet werden.
Die Strategie
Als Amalia 1997 nach Brasilien zog, machte sie sich daran, die Muster sozialer Investitionen im Land zu ändern, um Geschlechterbeziehungen und Vielfalt zu priorisieren. Amalias erster Schritt war die Einrichtung eines Fonds, der Mittel für Frauenorganisationen und -initiativen leiten würde. Gleichzeitig würden der Fonds und die entsprechende Aufklärungskampagne das Verständnis und die Sichtbarkeit der wichtigen Rolle der Frauen in der sozioökonomischen Entwicklung des Landes fördern. Amalia äußerte zunächst ihre Idee zur Einrichtung eines solchen Fonds und gewann die Unterstützung und den Beitrag von Kollegen und Frauenrechtlerinnen. Ursprünglich als Programm innerhalb der Frauenrechtsorganisation CEMINA in Rio gestartet, gründete Amalia 2001 den Angela Borba Fund mit anfänglicher finanzieller Unterstützung der Ford Foundation und des Global Fund for Women. Nachdem sie diese Unterstützung und Glaubwürdigkeit erlangt hatte, registrierte Amalia den Fonds unabhängig und strukturierte die Institution auf der Grundlage der gleichen Werte der Vielfalt und der Förderung von Fraueninitiativen. Sie richtete ein Gremium ein, um Vorschläge zu prüfen, mit neun Beratern, die sich in ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, sexuellen Orientierung und ihrem Alter unterscheiden. Sie legte die Parameter des Fonds fest, um Projekte zu unterstützen, die die Beschäftigung und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen fördern, den Zugang zu formaler und nicht formaler Bildung verbessern, Gewalt gegen Frauen bekämpfen, die Gesundheit von Frauen verbessern, den Zugang zu Technologie und Kommunikation ansprechen, die Kunst und Kultur von Frauen unterstützen und verteidigen Vielfalt und Unterschiede auf ethnischer, rassischer, sexueller und generationsspezifischer Ebene. Die Förderprioritäten umfassen einen dreigleisigen Ansatz zur Unterstützung von Gruppen, die keine Möglichkeit haben, Ressourcen auf andere Weise zu mobilisieren, deren Programme und Projekte die Menschenrechte von Frauen fördern, und Organisationen, die sich speziell für lesbische, schwarze oder indigene Frauen einsetzen Gruppen. Amalia hat ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren entwickelt, das die Werte des Fonds widerspiegelt: Ethik, Vielfalt und Gleichberechtigung. Die Kandidaten müssen ihre Projekte unter einem Pseudonym mit allen Informationen über die Organisation und Referenzen in einem verschlossenen Umschlag einreichen. Amalia hat diese Methode entwickelt, um eine Bevorzugung aufgrund persönlicher Verbindungen zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Finanzierung nach ausdrücklichen Kriterien erfolgt. Dies ermöglicht einen besseren Zugang für Organisationen, die nicht in einer Kultur „verbunden“ sind, in der man bekommt, was man will, von wem man weiß. Amalias sorgfältige Maßnahmen haben den Auswahlprozess so objektiv wie möglich gestaltet. Im November 2001 eröffneten Amalia und ihr Team den ersten Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen. In einem Monat erhielt der Fonds 110 Projekte aus vier der fünf Regionen Brasiliens. Im Februar 2002 traf sich der Vorstand, um 14 Projekte auszuwählen, die vom Angela-Borba-Fonds unterstützt werden sollen. Jede der Organisationen unterstützt (durchschnittlich) 800 Frauen – insgesamt 11.200 direkt betroffene Frauen. Amalias Strategie zur Schaffung einer nachhaltigen Finanzierungsquelle für den Angela-Borba-Fonds stimuliert nicht nur eine Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen und Einzelpersonen ihre philanthropischen Praktiken betreiben, sondern beinhaltet auch die Mobilisierung verschiedener Bereiche der Gesellschaft. Erstens spricht sie die Notwendigkeit an, Ergebnisse zu dokumentieren und Frauenorganisationen in Brasilien zu kartieren, um ihre Bedeutung für die soziale Transformation zu beweisen. Zu diesem Zweck hat sie drei Freiwillige an der Universität (mit einem Personalkoordinator) engagiert, die derzeit an einer breit angelegten Studie zu Geschlecht und sozialer Entwicklung in Brasilien beteiligt sind. Sie nutzt die Ergebnisse dieser Studie, um Workshops und Frühstückstreffen mit Unternehmen durchzuführen, um die Bedeutung von Geschlechterverhältnissen und Gleichberechtigung zu diskutieren. Außerdem gründet sie sowohl die „Friends of the Angela Borba Fund“ – eine Vereinigung, die als Bank von Spendern und Unterstützern dient – als auch einen ehrenamtlichen Vorstand mit berühmten und hoch angesehenen weiblichen Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und sozialen Sektoren, um die Initiative mit ihrem Namen zu unterstützen. Amalia glaubt, dass sie durch diese aggressive Aufklärungskampagne die Investitionskultur in Brasilien verändern und eine nationale Finanzierungsquelle schaffen kann. In fünf Jahren will sie den Fonds fast ausschließlich mit „lokal finanzierten“ Maßnahmen unterstützen. Amalia erkennt auch die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung in Brasilien an, um Anreize für soziale Investitionen zu schaffen. Sie setzt sich für eine Reform der Steuergesetze ein, die Steuerabzüge für Spender schaffen würde, und für die Fähigkeit des Fonds, eine Stiftung zu erhalten. In 10 Jahren plant Amalia, eine Stiftung für den Fonds zu schaffen, um seine langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen.