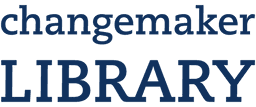Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Judy KornDeutschland • Violence Prevention Network e.V.
Ashoka-Fellow seit 2007
Ashoka-Fellow seit 2007
Bei ihrer Arbeit mit jungen und gewalttätigen Rechtsextremisten erkannte Judy Korn, dass Hassverbrechen durch diese Gruppe und andere Extremisten sowie Rückfallquoten zunehmen, dass die eigentlichen Ursachen für diese ethnozentrisch motivierten Gewalttaten jedoch nicht angegangen werden. Sie geht dieses Problem durch ein gezieltes Gefängnispräventionsprogramm an, das ideologische Einstellungen und Verhaltensweisen abbaut und die Jugendlichen stabilisiert, sich nach ihrer Entlassung von ideologischen Hassverbrechen zu enthalten.
Die Person
Judy ist seit ihrer Jugend Unternehmerin. In Berlin aufgewachsen, erlebte sie in den 1980er Jahren gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Jugendlichen in ihrem Kiez. Ihre erste Reaktion war, sich der antifaschistischen Bewegung anzuschließen, um gegen die Neonazis zu protestieren. Sie erkannte jedoch bald, dass Gegengewalt und die Weigerung, mit rechtsgerichteten Jugendlichen zu kommunizieren, das Problem nicht lösten. Die Neonazis wurden gewalttätiger und ihre Freunde wurden immer noch von ihnen angegriffen. Mit vierzehn Jahren nahm sie all ihren Mut zusammen und wandte sich an eine Gruppe von Neonazis in ihrer Gemeinde, um sie zu fragen, warum sie sich so verhalten. Ihr wurde klar, dass die Jugendlichen – die aus armen Gegenden kamen – sich wirklich darüber beschwerten, dass sie sich ausgeschlossen fühlten und keinen Platz hatten, um sich zu treffen. Im Gegenzug motivierte sie sie, ein Jugendzentrum zu bauen. Sich ihren Respekt verdienen, indem sie ihnen zuhörten und sie als Individuen wertschätzten – Judy forderte ihre ideologischen Argumente und gewalttätigen Taten heraus. Die Jugendlichen nahmen ihre Fahnen mit rechtsextremen Symbolen ab – obwohl sie immer noch kurz geschnittene Haare trugen – und nahmen friedlich am Jugendzentrum teil; Verzicht auf Gewalt. Judy war in der Lage, demokratische Ideen in ansonsten geschlossenen Kreisen einzuführen, und erkannte, dass sie einen kommunikativen, integrativen Zugang zu extremistischer Ideologie und gewalttätiger Jugend gefunden hatte, der den Wert der Person von ihrer Tat trennte. Um ihr Verständnis und ihre Erkenntnisse zu vertiefen, studierte sie Pädagogik. Sie arbeitete weiterhin mit radikalen Jugendlichen an der Universität und später als Dozentin. Bevor sie mit ihrem Gefängnisprojekt begann, startete sie ein bahnbrechendes Vermittlungs- und Anti-Gewalt-Programm an Schulen. Um Gewalt zu reduzieren, musste sie die gewalttätigsten und gefährdetsten Schüler in das Zentrum einbeziehen und sie nicht an den Rand drängen. Sie bildete sie zu Gewaltpräventionsspezialisten und Mediatoren aus, weil sie sie als „Gewaltexperten“ empfand und diese Expertise konstruktiv einbringen sollte. Das Programm war ein großer Erfolg und führte zu deutlich niedrigeren Aggressionsraten. An vielen städtischen Schulen in Berlin ist es noch immer im Einsatz.
Die neue Idee
Judy befasst sich mit dem weit verbreiteten und wachsenden Problem ethnozentrisch motivierter Gewalt. Sie erkennt an, dass alle Jugendlichen, die Hassverbrechen begehen – seien es Rechtsextreme oder andere ideologische Extremisten – im Wesentlichen ähnliche Denk- und Verhaltensmuster teilen: Die meisten sind persönlich geplagte Mitläufer und verwenden ideologische Erklärungen als oberflächliche Gründe für ihre Verbrechen. Judy hat das erste Rehabilitationssystem geschaffen, das es Straftätern ermöglicht, den Teufelskreis aus persönlicher Frustration, Fanatismus, Gewalt und Rückfällen zu durchbrechen. Indem sie gleichzeitig die motivationalen, verhaltensbezogenen, ideologischen und sozialen Wurzeln ihrer Straftaten angeht, stärkt Judy die Jugendlichen sowohl innerhalb des Gefängnisses als auch nach der Entlassung, um sich von ideologisch radikalen Einstellungen und Handlungen zu distanzieren. Durch ein facettenreiches Training arbeitet sie mit den Jugendlichen an ihrer persönlichen Biographie, um die ideologische Rechtfertigung ihrer Verbrechen zu demontieren und sie dazu zu bringen, Verantwortung für das zu übernehmen, was sie getan haben. Darüber hinaus ermöglichen ihre Trainer den emotional entfremdeten Gefangenen, ihre Aggressionen zu kontrollieren und es zu wagen, Beziehungen aufzubauen; So können sie ein unterstützendes Netzwerk sorgfältig ausgewählter Freunde oder Familienmitglieder aufbauen, an die sie sich nach ihrer Entlassung wenden können. Sie erweitert ihr System, indem sie Trainer ausbildet; Verbreitung in Deutschland und darüber hinaus. Ihre Methodik, die auch relevante Unterstützungseinrichtungen für die Nachsorge einbezieht, hat zu einer dramatisch niedrigeren Rückfallquote geführt. Judy hat ihr Ziel bewiesen, dass ihr Konzept funktioniert, indem sie sich auf eine sehr gefährliche und knifflige Zielgruppe konzentriert, und weiß, dass es für andere gewalttätige Straftäter funktionieren wird, mit dem Potenzial, die Behandlung gewalttätiger Gefangener auf internationaler Ebene zu beeinflussen.
Das Problem
Viele Gruppen hegen den Glauben, dass ihre Kultur, Religion, ethnische Zugehörigkeit oder soziale Klasse denen einer anderen Gruppe überlegen sind, was sich normalerweise in latenter oder offener Fremdenfeindlichkeit ausdrückt. Gepaart mit ungünstigen Umständen kann es auch zu Gewaltanwendung gegenüber als minderwertig wahrgenommenen Personen kommen. Radikalismus und rechte Verbrechen sind in vielen Ländern ein Problem, darunter Nordirland, Frankreich, Spanien und das ehemalige Jugoslawien. Jenseits des offensichtlichen Schadens, der den Opfern und ihrem Umfeld zugefügt wird, beeinträchtigt jedes Hassverbrechen die Gesellschaft als Ganzes erheblich: Die Bürger fühlen sich unsicher, die Nation leidet unter Identitäts- und Imageproblemen und es herrschen Schamgefühle, Wut und Hilflosigkeit vor. In Deutschland ist das Problem angesichts der jüngeren Geschichte des Landes besonders heikel. Die Zahlen sind besorgniserregend: Zwischen 2001 und 2007 zählte die Statistik 6.600 rechtsextrem motivierte Gewaltdelikte, meist in Gruppen begangen, also gibt es eine grobe Schätzung von 16.500 Straftätern. Laut einer in Berlin durchgeführten Studie waren rund 75 Prozent der rechtsradikalen Straftäter zwischen 15 und 24 Jahre alt, nur 6,3 Prozent waren weiblich. Die Gesellschaft versteht die Auslöser für Radikalismus nicht und es fehlt an angemessenen Antworten auf Extremismus. Rechtsextreme gelten entweder als undemokratische Ausgestoßene, für die harte Strafen gefordert oder stillschweigend unterstützt werden. Beide Ansätze scheitern daran, die radikale Szene konstruktiv zu erreichen und zu stärken. Auf der Suche nach den Ursachen von Radikalismus haben psychologische Studien herausgefunden, dass abweichendes Verhalten bei Jugendlichen eng mit der Struktur und Qualität ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen zusammenhängt. Junge Straftäter, die Hassverbrechen begehen, stammen in der Regel aus schwierigen familiären Verhältnissen (Scheidung, Fahnenflucht und Missbrauch sind in ihrem Leben allgegenwärtig), und Gewalt ist zu einem Verhaltensmuster geworden, das von Kindheit an erlernt wurde. Hohe Arbeitslosigkeit und Drogenmissbrauch in ihrer marginalisierten Gemeinschaft schüren die Frustration weiter und führen zu einer Spirale der Gewalt. Das Ergebnis ist ein junger Mensch mit einem verminderten Selbstvertrauen, dem es an grundlegendem Einfühlungsvermögen mangelt, der gewalttätig kommuniziert und sich eher mit Gruppen identifiziert, die „Außenstehende“ diskriminieren, um sich überlegen und selbstbewusster zu fühlen. Die überwiegende Mehrheit der ideologischen Straftäter besitzt keine tief verwurzelten rassistischen Überzeugungen, sondern ist Mitläufer der rechten Szene und Pseudoanhänger ethnozentrischer Ideologie. Obwohl sie einst Teil einer extremistischen Bande waren, ist es für die Jugendlichen sowohl psychisch schwierig als auch körperlich gefährlich, sie zu verlassen – aufgrund des starken Gruppen- oder Gruppendrucks. Die steigende Zahl von Hassverbrechen und der Mangel an sozialen Lösungen, die von den Regierungen angeboten werden, hat zu öffentlichen Forderungen nach einer harten Bestrafung junger Extremisten als Abschreckung geführt. Rehabilitationsversuche haben sich als weitgehend wirkungslos erwiesen: 78 Prozent der ehemaligen deutschen Jugendhäftlinge werden rückfällig; etwa die Hälfte von ihnen wird innerhalb von drei Jahren erneut inhaftiert. Seit Jahrzehnten sind die Rückfallquoten ähnlich hoch. Gegenwärtige Gefängnispräventionsprogramme zeigen wenig Wirkung bei der Reduzierung von Rückfällen. Keine bestehenden Trainings- oder Rehabilitationsbemühungen sprechen radikale Motivationen an; Erstens, weil rechte und andere extremistische Ideologien so hässlich sind, dass sich nur wenige damit auseinandersetzen wollen, und zweitens, weil herkömmliche Methoden der politischen Bildung mit Filmen und Vorträgen – z. Ereignisse des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslagern – haben sich als unwirksam erwiesen, um rechte Gangmitglieder zu erreichen. Das Strafvollzugssystem bietet keine kontinuierliche Unterstützung während der Haft oder Betreuung nach der Entlassung. Die Gefahr, in die destruktiven Strukturen ihrer ehemals rechten Peer Groups zurückzufallen, ist enorm. Die meisten Straftäter verfallen innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung wieder in die Gewalt, wenn sie mit Problemen wie der Suche nach einer Wohnung, einem Job, einer Freundin oder unterstützenden und vertrauensvollen Partnern konfrontiert werden. Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer können nicht die Rolle unterstützender Ansprechpartner einnehmen, da sie als Kontrollinstanz wahrgenommen werden.
Die Strategie
Judy entdeckte, dass sich Extremisten am ehesten ändern, wenn sie inhaftiert und isoliert sind. Daher beginnt Judy mit Straftätern im Gefängnis. Sie verwendet einen dreiteiligen Ansatz, um den Kreislauf von persönlichen Problemen, Radikalismus, Gewalt und Rückfällen zu durchbrechen. Ihr Programm stärkt den Täter, ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben zu führen und sich von der faschistischen Ideologie zu distanzieren; Dies erhöht die Fähigkeit des Umfelds, konstruktiv auf nicht-demokratische Einstellungen oder Verhaltensweisen zu reagieren, und verändert das Justizsystem, um eine systematische Nachsorge zu leisten. Judy arbeitet seit ihrem 14. Lebensjahr an der Demokratisierung gewaltbereiter rechter Jugendlicher und hat tiefe Einblicke in das Warum und die Funktionsweise extremistischer Banden gewonnen. Soziale Ausgrenzung, der Mangel an konstruktiven zwischenmenschlichen Beziehungen und ideologische Flucht führen dazu, dass sich Jugendliche mit geringem Selbstwertgefühl radikalen Gruppen zuwenden, um sich zugehörig zu fühlen. Judy und ihr Team gründeten 2001 in Brandenburg das Programm „Verantwortung übernehmen – Aufbruch aus Hass und Gewalt“. Sie arbeitet direkt mit unangesprochenen jungen Extremisten, wenn sie wegen Hassverbrechen inhaftiert sind. Das Freiwilligenprogramm kombiniert eine fünfmonatige Ausbildung im Gefängnis mit einer einjährigen individuellen Nachbetreuung nach der Entlassung. Trainer werden aus unterschiedlichen Berufsgruppen rekrutiert und verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit radikalen Jugendlichen. Ausbilder werden von außerhalb der Haftanstalt ausgewählt, um das Vertrauen der Insassen zu gewinnen. Das Programm beinhaltet, die problematischen Jugendlichen emotional zu stärken, demokratisches Denken zu fördern und ihnen beizubringen, Verantwortung für ihr Handeln und Leben zu übernehmen. Judys Schlüssel ist es, die Person und die Tat freizuschalten. Ihre Trainer versuchen nicht, die Jugend zu „brechen“, wie es in einem Bootcamp üblich ist, oder ihre Verbrechen überbetonen und trivialisieren. Stattdessen begegnen sie den Tätern mit Respekt und machen gleichzeitig deutlich, dass sie das begangene Verbrechen nicht akzeptieren ihr Verbrechen. Die Ausbilder hören den Insassen zu, lenken die Täter aber dahin, zu erkennen, dass es sinnlos ist. Ziel ist es, Argumente wie ethnozentrische Überlegenheit, vermeintliche Koinzidenz oder Gruppenzwang durch systematisches Hinterfragen zu entkräften, bis der Trainer sagt: „Informiere dich besser darüber, wovon du sprichst. Treffen wir uns das nächste Mal, um die Diskussion fortzusetzen.“ So werden die jugendlichen Straftäter Schritt für Schritt an die Widersprüchlichkeit ihrer Argumentation herangeführt, was langsam ein Umdenken auslöst. Da sie sich vom Trainer persönlich akzeptiert fühlen, beginnen sie Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Rollenspiele und praktische Übungen helfen den Insassen dabei, Methoden der friedlichen Konfliktlösung zu erlernen und dem Gruppendruck entgegenzuwirken, um ihr Verhalten und ihre Entscheidungsfindung zu ändern. Radikalisierte Insassen werden mit politisch gemäßigteren Insassen vermischt, was zu einer Gruppendynamik führt, die Veränderungen fördert. Judy erkannte die kritische Natur der Zeit nach ihrer Freilassung und begann 2003 mit dem Aufbau systematischer Nachbetreuungsstrukturen. Ein Jahr lang werden die Jugendlichen durch ein Eins-zu-eins-Mentoring durch den Trainer und sorgfältig ausgewählte Netzwerke unterstützt. Während des Trainings erleben die Jugendlichen oft zum ersten Mal eine verlässliche, echte Beziehung zum Trainer und Anerkennung als Person, was Empathie auslöst. Um den Aufbau zwischenmenschlicher Vertrauensbeziehungen zu wiederholen und zu üben, werden die Jugendlichen vor ihrer Entlassung gebeten, geeignete Mitglieder ihres unmittelbaren Netzwerks zu identifizieren, die außerhalb der Haft konstruktive Unterstützung leisten könnten. Diese Personen werden zu zwei „Familientagen“ im Gefängnis eingeladen. Positive Aspekte der Beziehung werden betont wie „Erzählen Sie mir von den Talenten Ihres Sohnes“ und gegenseitige Erwartungen werden geklärt. Erweist sich das familiäre Umfeld als zu destruktiv oder die ehemalige Bande zu gefährlich, helfen Trainer dem Jugendlichen beim Umzug oder finden andere Vertrauenspersonen. Trainer haben eine wichtige Rolle in der Nachsorgestruktur. Vor der Entlassung bewertet der Jugendliche seine persönliche Situation mit der Gruppe und dem Trainer. Er plant die Bewältigung des Alltags und die nächsten Schritte, darunter einen „persönlichen Sicherheitsplan“, der konkrete Maßnahmen gegen gewalttätige oder emotionale Rückschläge enthält. Trainer stehen über eine 24-Stunden-Krisen-Hotline zur Verfügung, um zu intervenieren oder persönliche Besuche zu machen. Kritische Situationen beinhalten typischerweise betrunkene Kämpfe, Zusammenstöße mit der alten Bande oder persönliche Krisen. Die allgemeine Entwicklung wird durch wöchentliche Gespräche überwacht, die die Beziehung fortsetzen und die Teilnehmer daran erinnern, was sie gelernt haben. Während er bei allen Herausforderungen des täglichen Lebens hilft, überwacht der Trainer weiterhin ihre Ideologie. Rechte Einstellungen verblassen oft, wenn die Jugendlichen Väter werden oder es gelingt, stabile Beziehungen aufzubauen. Geschätzte 40 Prozent der Anspruchsberechtigten nutzen regelmäßig das gesamte Nachsorgeangebot. Da Judy noch nicht über die nötigen Ressourcen verfügt, um sich um alle zu kümmern, vernetzt sie die Entlassenen mit anderen Hilfsorganisationen und Behörden. Zu den Kooperationen gehören die Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche, die Erledigung bürokratischer Aufgaben oder die Suche nach einer Therapie. Bisher haben 200 rechte Insassen an 25 Trainings teilgenommen, mit beeindruckenden Ergebnissen. Den Auswertungen zufolge haben mehr als 90 Prozent Gewalt und Gefängnis vermieden. Judy ist sich bewusst, dass ihre Teilnehmer nicht immer über Nacht zu vollwertigen Demokraten werden, aber sie hat es geschafft, sie von der aktiven Szene wegzubewegen. Einige der Teilnehmer haben so dramatische Veränderungen durchgemacht, dass sie jetzt als Co-Trainer in neuen Gefängnisprogrammen mit jungen Migranten fungieren. Regierungsbeamte bestätigen, dass die vorläufige Erfolgsquote des Programms 90 Prozent beträgt, mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Gesamtrehabilitationsquote. Eine Studie der Universität Erfurt ergab, dass ehemalige Häftlinge ein höheres Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen besitzen, seltener in gewalttätige Konflikte verwickelt sind und eine positive Lebenseinstellung haben. Mit einer Investition von 8.000 bis 10.000 EUR pro Person und Jahr kostet Judys Programm deutlich weniger als andere Präventionsprogramme (15.000 oder mehr). Angesichts der niedrigen Rückfallquote und der durchschnittlichen Kosten eines Gefangenen von 100 EUR pro Tag ist es langfristig günstiger. Judy erweitert derzeit ihr Programm geografisch und schließt religiös oder kulturell motivierte Verbrechen, einschließlich interethnischer Rivalität, ein. Sie delegiert die Ausbildung im Gefängnis an ihr Team und konzentriert sich auf die Erweiterung und die Methoden, um eine breitere Gesellschaft zu erreichen. Sie und ihr Team haben einen 18-monatigen standardisierten Schulungsplan erstellt, der zwölf Fachleuten beigebracht wird, um zwischen 2007 und 2008 sechs bis acht Regionen zu erreichen. Sie wählt sorgfältig Trainer aus ihren Netzwerken aus, darunter Psychologen, Sozialanthropologen oder Streetworker. 2004 begann sie mit der Replikation eines weiteren Programms, das inzwischen in sechs deutschen Bundesländern unter Beteiligung der Bundeszentrale für politische Bildung, der konservativen Landesjustizministerien und seit 2003 des Europäischen Sozialfonds mit dem Programm XENOS läuft. Judy arbeitet auch mit internationalen akademischen Institutionen zusammen. Ihr Ziel ist es, dass ihre Methodik in allen Gefängnissen mit Gewalttätern zum Stand der Technik wird. Da ihre Methodik mit einer der schwierigsten Gruppen funktioniert – gewaltbereiten rechten Insassen – sollte sie auch mit anderen gewalttätigen Straftätern funktionieren. Judy arbeitet auch transnational mit Kriminalpräventionsorganisationen in Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden zusammen, um ihr Programm zu übernehmen. Darüber hinaus übernimmt Nordirland sein Programm zur Bekämpfung religiös motivierter Verbrechen. Zuletzt wendete Judy ihr Interventionsinstrument auf radikale Einwanderer mit überwiegend arabischem Hintergrund an, die Gangmitglieder sind und sich an interethnischen und fremdenfeindlichen Gewalttaten beteiligen. Derzeit bildet sie Experten für die Subkultur von Einwanderern aus. Judy arbeitet auch mit Menschen zusammen, die täglich in direktem Kontakt mit straffälligen Jugendlichen stehen, darunter Bewährungshelfer und öffentliche Wohlfahrtsdienste, um ihnen zu helfen, konstruktiv auf undemokratische Einstellungen oder Verhaltensweisen zu reagieren. Sie bietet Justizvollzugskräften Schulungen zur rechtsextremen Szene und zur Argumentation im Umgang mit rassistischen Parolen an. Sie bietet eine Hotline für dringende Fragen und Informationen zum Programmkonzept. Um Jugendliche zu erreichen, bevor sie Hassverbrechen begehen, arbeitet Judy mit Organisationen zusammen, die Jugendlichen mit hohem Gewaltrisiko helfen, wie z. B. Jugendzentren. Bis heute wurden 1.000 Personen aus unterschiedlichen Branchen in ihren Methoden geschult. Die Qualifizierung wird gut angenommen, da Rassismus zwar nicht öffentlich zugegeben wird, aber ein weit verbreitetes Problem ist. Judy wusste, dass die Einführung stärkender Nachsorgestrukturen für einen reibungsloseren Übergang vom Gefängnis zurück ins normale Leben eine Änderung des Justizsystems erfordern würde. Mit ihrem starken Netzwerk öffentlicher Institutionen hat sie sich dafür eingesetzt, dass ein Gesetz in den verabschiedeten neuen Jugendstrafvollzug in Deutschland aufgenommen wird. Sie wird eine systematische Nachsorge für die Jugendrehabilitation erfordern und den Präventionsbemühungen starke Impulse geben.
Judy Korn