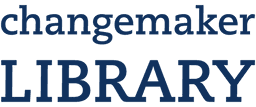Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Till BehnkeDeutschland • betterplace
Ashoka-Fellow seit 2008
Ashoka-Fellow seit 2008
Till Behnke hat einen Online-Marktplatz für kleine Spender und Bürgerorganisationen (COs) entwickelt, der radikale Transparenz bietet und es Benutzern ermöglicht, die Glaubwürdigkeit von COs zu beurteilen und fundierte Spendenentscheidungen zu treffen. Die Plattform legt auch die Verantwortung und die Macht, sich für Unterstützung zu sammeln, in die Hände von COs.
Die Person
Kurz nach der High School zog Till allein in ein Internat in Kapstadt, Südafrika, um professionelles Rugby zu spielen, und wurde dort zum ersten Mal mit bitterer Armut konfrontiert. In seiner Freizeit begann er, sich ehrenamtlich für eine Reihe lokaler Entwicklungsprojekte zu engagieren, darunter das lokale Kapitel von Habitat for Humanity. Im Jahr 2000 kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich dem kürzlich gegründeten, heute weltweit tätigen IT-Unternehmen Paybox an. Till half dabei, Paybox durch seine frühen Wachstumsphasen zu führen. Er war verantwortlich für den Aufbau von Vertriebsnetzwerken von Taxifahrern bis hin zu großen Telekommunikationsunternehmen und erfand neue Finanz-Cashflow-Anwendungen für Benutzer, wobei er viel über den Betrieb eines Start-ups und Finanzsysteme lernte. Anschließend ging er aufs College und gründete zusammen mit einem Freund eine kleine Webdesign-Firma für lokale Unternehmen in Heidelberg. Nach seinem Studium wechselte Till zu Daimler und spezialisierte sich auf Corporate Fleet Management. Er arbeitete mit einem zwanzigköpfigen Team in der Berliner Zentrale. Nach einigen Jahren war er mit dem Firmenleben unzufrieden und wollte sich von der Struktur und Bürokratie befreien. Er wollte sowohl die kleine, freilaufende Startup-Umgebung von Paybox als auch den sozialen Zweck seiner Entwicklungsarbeit in Südafrika wiedererlangen. Er stellte fest, dass viele seiner Freunde dort immer noch mit kleinen, unterfinanzierten afrikanischen Entwicklungsprojekten arbeiteten, während seine Freunde in Deutschland beklagten, dass das Spenden keinen Spaß mache, kompliziert sei und sich daher nicht lohne. Till trug daher die Idee von betterplace.org und gründete sie 2006, bevor er Anfang 2007 bei Daimler ausschied. Dass exzellente IT- und Online-Marketing-Kenntnisse für den Erfolg seines Projekts entscheidend sein würden, sicherte Till sich von Anfang an Unterstützung kritischer Akteure der europäischen IT-Geschäftswelt, darunter der Gründer von Alando/eBay Deutschland, sowie mehrere andere Gründer und Geschäftsführer von IT- und E-Marketing-Unternehmen.
Die neue Idee
Anstatt eine weitere Online-Philanthropie-Plattform aufzubauen, hat Till einen transparenten, sich selbst regulierenden Online-Marktplatz, betterplace.org, für kleine Spender und kleine COs entwickelt, der aufgrund seiner strukturellen Architektur einzigartig ist, die er das „Web of Trust“ nennt. Till kombiniert die Bewertungssysteme, die auf den „Wisdom of the Crowd“-Prinzipien von Websites wie eBay oder Amazon basieren, mit den Techniken sozialer Netzwerke von Websites wie Linked-in. betterplace ermöglicht es COs sichtbar zu werden, wenn sie erfolgreich die Unterstützung von Begünstigten, Freunden und Spendern gewinnen, die wiederum eine Organisation per Mausklick und Kommentare weiterempfehlen können. Bewertungen sind wie Linked-in für jeden Benutzer sichtbar und beinhalten die Nähe des Bewerters zum CO und – einzigartig bei betterplace – seine Beziehung zur Organisation: Sei es Spender, Begünstigter, Endbenutzer, Konkurrent oder einfach Freund. Diese Informationen ermöglichen es den Benutzern, die Bewertungen und Kommentare in einem neuen Licht zu interpretieren. So entstehen auf betterplace.org ein „Web of Trust“ und Beziehungen, die radikal transparent sind. Jeder Benutzer kann entscheiden, ob er den Gutachtern vertraut, welchen Bewertungen er am meisten vertraut (z. B. denen von Endnutzern oder Spendern), und kann so sicherere Entscheidungen darüber treffen, wo er sein Geld investiert. Damit ermöglicht Till nicht nur Tausenden von Kleinspendern, zu strategischeren Investoren zu werden, er erhöht auch das Spendenvolumen und fördert die Rechenschaftspflicht, und nicht zuletzt verhilft er versteckten sozialen Champions im Bürgersektor zum Entstehen: Sie können jetzt aktiv ihre eigenen machen Stimme auf dem Investmentmarkt gehört werden, ohne von ineffizienten, aber bekannteren Wohlfahrtsinstitutionen in den Schatten gestellt zu werden. Um Traffic zu gewinnen und Impulse zu setzen, baut Till Netzwerke mit Institutionen auf, die seine Arbeit nutzen können: Beispielsweise zahlen Unternehmen eine Gebühr für die Vermittlung ihrer Mitarbeiter an betterplace und für die Verwendung von Gehaltsrundungssystemen, um das Spenden der Mitarbeiter zu fördern. So garantiert Till privaten Nutzern, dass 100 Prozent der über betterplace gespendeten Gelder bei den Zielorganisationen ankommen, egal ob es sich um 5 oder 500 Euro handelt. Auf diese Weise beseitigt Till systematisch weitere Barrieren, die Kleinspender bislang daran hinderten, strategisch zu spenden.
Das Problem
In Deutschland hinkt die private Philanthropie den USA deutlich hinterher. Zu Weihnachten und bei Naturkatastrophen steigt die Zahl der Spenden für wohltätige Zwecke, bleibt aber ansonsten relativ gering: Nur 37 Prozent der Bevölkerung spenden überhaupt. Der überwiegende Teil der Spendengelder geht an große Organisationen wie UNICEF, das Rote Kreuz oder die Katastrophenhilfe. Die Bürger werden entweder durch ihre persönlichen Netzwerke oder große gemeinnützige Marketingkampagnen zum Spenden angezogen. Unter jungen Menschen ist das Spendenniveau besonders gering – sie haben keine persönliche Erfahrung mit der Armut und den Entbehrungen der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigen aber gleichzeitig das größte Interesse, an der Spitze sozialer Bewegungen zu stehen. Venture Philanthropy ist in Deutschland sehr neu, wird aber nur als Konzept verstanden, das für Millionäre relevant ist, die riesige Summen investieren wollen. Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zögern aus mehreren Gründen, sich regelmäßig philanthropisch zu engagieren: Mangel an Informationen und Vertrauen. Es ist schwierig, soziale Initiativen zu finden, die sowohl effektiv sind als auch den eigenen Interessen entsprechen. Der soziale Sektor ist stark fragmentiert. Einzelne Spender müssen ihre eigenen Nachforschungen anstellen und Informationen sammeln, wenn sie strategisch spenden wollen, ohne den Vorteil von Organisationen wie Guide Star oder einer bequemen zentralen Plattform, die ihnen hilft, eine Vielzahl von Projekten im sozialen Sektor zu werben und ihre jeweiligen Verdienste zu vergleichen. Bisher gab es im deutschsprachigen Raum keine Online-Spendenmarktplätze. Derzeit gibt es keine vertrauenswürdige Quelle, die die Qualität kleiner Organisationen bewertet, indem sie die Ansichten aller Beteiligten einbezieht, einschließlich ihrer Investoren, Sponsoren, Freiwilligen, sozialen Organisationen und Endbegünstigten. Expertenbewertungen von Stiftungen, Regierungsorganisationen oder Philanthropieberatern existieren, aber sie sprechen den normalen Bürger nicht an, da sie schwer verständlich sind und nur die Seite des Investors darstellen. Intransparenz der sozialen Wirkung. Wenn Spender an das Rote Kreuz oder Unicef spenden, sehen sie die direkte Wirkung ihrer Spende nicht und fühlen sich daher nicht als Teil einer Bewegung für sozialen Wandel. Sie haben typischerweise keinen direkten persönlichen Kontakt mit dem sozialen Sektor in den Entwicklungsländern, und sie wissen nicht, welche Gruppen vertrauenswürdig sind und wirklich Einfluss haben. Selbst nachdem sie Geld investiert haben, gibt es wenig Transparenz oder direkte Kommunikation – Investoren können nicht sehen, wie ihr Geld ausgegeben wird oder welche unmittelbaren Auswirkungen es hat. Folglich ziehen sie sich entweder zurück oder nehmen eher eine Wohltätigkeitsansicht als die eines aktiven Investors an. Hohe Overhead- und Übertragungskosten. Sowohl Spender als auch Empfänger haben den „Long Tail of Charity“ satt. Ein Großteil der Spenden geht auf dem Weg zu sozialen Initiativen verloren, weil Geberorganisationen 30 bis 50 Prozent der eigenen Spende auffressen und internationale Geldtransfers manchmal weitere 30 Prozent wegschneiden. Dies macht es ineffizient, häufig (z. B. monatlich) kleine Spenden zu leisten, da ein erheblicher Teil von den Institutionen und Banken abgeschöpft wird, die die Überweisungen abwickeln. All diese Faktoren zusammen machen es potenziellen Spendern leicht, das Gefühl zu haben, dass sie gute, rationale Gründe haben, nicht zu spenden: Es ist schwierig, die richtige Investitionsentscheidung zu treffen, geschweige denn, sie zu genießen. Eine andere Dimension des Problems betrifft speziell kleine COs (einschließlich kleiner Projekte auf Gemeindeebene), sei es in Deutschland oder in den Entwicklungsländern, die nicht über das Budget verfügen, um im Ausland Werbung zu machen. Diese Organisationen, von denen viele intelligent und zielgerichtet sind, sind in der Regel auf externe Medienorganisationen angewiesen, um ihre Arbeit bekannt zu machen. Diejenigen, die in abgelegenen Gebieten operieren, sind besonders von der Öffentlichkeit abgeschnitten. Größere, institutionellere Wohltätigkeitsorganisationen mit gut finanzierten PR-Büros verfügen über den Löwenanteil der öffentlichen Unterstützung, während kleine und versteckte Champions keine Sichtbarkeit haben und nach Finanzierung hungern.
Die Strategie
Till versteht, dass es zur Schaffung eines vollständig selbstregulierenden Marktplatzes nicht ausreicht, kleinen COs zu ermöglichen, Informationen über sich selbst zu veröffentlichen und Community-Bewertungen zu ermöglichen. Spender spenden an Organisationen, denen sie vertrauen können. Deshalb hat er die innovative „Web of Trust“-Technologie entwickelt, die es erstmals allen Interessengruppen rund um Projekte ermöglicht, an Vertrauenswürdigkeitsbewertungen teilzunehmen. Das Web of Trust nutzt die Weisheit der Masse, die durch Zufriedenheitsbewertungen erfasst wird, wie sie beispielsweise von Amazon.com oder eBay verwendet werden. Natürlich können COs bei betterplace auch ihr Profil präsentieren, Bilder und Berichte hochladen, angeben, wofür sie Geld brauchen und warum etc. Neu ist aber Folgendes: Projekte werden quantitativ, auf einer Fünf-Punkte-Skala, und auch qualitativ durch bewertet von der Organisation veröffentlichte Jahresberichte, Berichte von Besuchern, informelle Kommentare und Verbindungen zu Blogs und Chats. betterplace fügt diesen Bewertungen ein soziales Netzwerksystem hinzu, wie es beispielsweise LinkedIn oder Xing verwenden (Beispiel: Jim Miller, der Projekt A unterstützt, ist ein enger Freund Ihres besten Freundes, er ist eng mit zehn anderen Personen in der verbunden Netzwerk, das Sie auch gut kennen und dem Sie vertrauen, daher ist sein Urteil sehr wahrscheinlich zuverlässig). Benutzer können sehen, was ihre Freunde und Mitarbeiter unterstützen und warum, und können im Lichte dieser Informationen Entscheidungen treffen. Alle Online-Mitglieder, die mit einem CO auf der Website verknüpft sind, werden in eine von fünf Kategorien eingeteilt: Experten mit Fachkenntnissen, Mitarbeiter und Endbenutzer, Investoren, besorgte Bürger oder Beobachter. Jede Nutzerin kann entscheiden, ob sie den Nominierenden eines Projekts vertraut. Auf diese Weise schafft es Till, radikale Transparenz in einen ziemlich undurchsichtigen Markt zu bringen, indem er nicht darauf wartet, dass Experten standardisierte Leistungskriterien entwickeln, die für die gesamte Branche gelten (manche halten dies für möglich), sondern das Wissen und die Weisheit der Masse herauskristallisiert . Künftig wird Till das Web of Trust mit einem „Personal Trust Index“ ausstatten, der anhand der Nähe des Nutzers zum empfehlenden Netzwerk die Vertrauenswürdigkeit eines Projekts für ein einzelnes Mitglied errechnet. Der Index wird die Entscheidungen der Nutzer weiter vereinfachen. Um Missbrauch zu vermeiden, hat Till ein internes Überwachungssystem geschaffen, das die IP-Adressen verfolgt, die zum Bewerten und Kommentieren gelisteter Projekte verwendet werden, aber er erwartet auch, dass der Markt selbst Missbrauch aufdecken wird. Till startete seine Plattform im November 2007 mit einer embryonalen Version seines Vertrauensnetzes, und die Website wächst schnell. Nach den ersten 12 Monaten können nun mehr als 700 Projekte aus 95 Ländern von den Nutzern der Seite finanziert werden. Im Dezember 2008 verzeichnete betterplace.org 100.000 neue Besucher, seit November 2007 wurden insgesamt mehr als 550.000 Euro an Spenden gesammelt und an die Projekte weitergeleitet. Rund 10.000 sind Mitglieder seiner Online-Community geworden, weitere 3.000 spendeten durch seine Verbindungen zu Firmenkunden. Um weiter zu expandieren und eine Massenbewegung aufzubauen, verfolgt Till Strategien auf mehreren Ebenen: Mit Hilfe von Marketingexperten der deutschen eBay-Niederlassung verfolgt Till eine Reihe von Marketingstrategien rund um seine Kernmarke betterplace. Online verbindet er sich mit Facebook-Anwendungen und nutzt eBay-Banner und kostenlose Werbeflächen von Google. Er ist bestrebt, nach freien Werbeflächen zu suchen, anstatt einen Großteil seines Startup-Budgets für Marketing zu verwenden. Er ermutigt die Nutzer auch, nicht nur die von ihnen finanzierten Projekte, sondern auch die betterplace-Plattform bekannt zu machen. Darüber hinaus arbeitet Till proaktiv daran, durch intelligente Kooperationen neue Nutzer zu gewinnen. Er beginnt mit Unternehmen, da sie ein natürliches Interesse daran haben, ihre Marke mit Philanthropie und positivem sozialen Wandel in Verbindung zu bringen, und sie können eine große Anzahl von Mitarbeitern für seine Plattform gewinnen. Um diesen Prozess zu erleichtern, erstellt betterplace.org gegen eine Gebühr ein maßgeschneidertes „Portal“ für das teilnehmende Unternehmen mit dem eigenen Logo und Design des Unternehmens, über das die Mitarbeiter auf betterplace.org zugreifen und aus einer Reihe von Projekten auswählen können. Das Portal befindet sich auf der Homepage des Unternehmens und ist für normale Benutzer, die betterplace betreten, nicht sichtbar. Der Automobilkonzern Daimler beispielsweise nutzt diesen Service gerade erst. Mitarbeiter von Kundenunternehmen können auch zustimmen, dass ihr monatlicher Gehaltsscheck leicht „abgerundet“ wird, und diese kleinen Summen einem bestimmten Projekt zuführen. Till führt solche Gehaltsrundungssysteme in den Jahren 2009 und 2010 ein. Schließlich arbeitet er daran, betterplace.org mit einem System zu verknüpfen, das die Rechnung, die Verbraucher in Einzelhandelsgeschäften zahlen, auf einen Bruchteil von 1 € „aufrunden“ würde. Teilnehmende Geschäfte würden die Kosten für die Handhabung einer großen Menge Kleingeld sparen und gleichzeitig eine Gelegenheit für positive Öffentlichkeitsarbeit bieten. Da sich kleine Beträge nicht wie ein großes Opfer anfühlen, würden Verbraucher es leicht finden, zu gewohnheitsmäßigen Gebern zu werden. Während Till vorerst auf den deutschen Markt abzielt, beabsichtigt er, sich international zu verbreiten, beginnend mit Südafrika, zwei seiner Mitbegründer leben. Er hat seine Plattform bereits in einer englischen Version gebaut. Er strebt auch Partnerschaften mit anderen Online-Philanthropie-Marktplätzen außerhalb Deutschlands an und hat mehrere Gespräche sowohl mit Globalgiving als auch mit Kiva geführt, um mögliche Kooperationen zu erkunden. Es geht ihm nicht darum, betterplace zur marktbeherrschenden Marke zu machen. Seine Strategie ist es vielmehr, Nutzer auf zwei Wegen zum Projekt von betterplace zu leiten: Entweder als „Hinterzimmer“, wie es bei Firmenkunden üblich ist, wo Nutzer über Co-Branding-Online-Portale vermittelt werden, oder als „Vorzimmer“ – Zeichnung Bürger direkt zu betterplace. Auf der „Nachfrage“-Seite bietet betterplace.org sozialen Gruppen die Möglichkeit, durch den Aufbau und die Pflege eines Webauftritts sowie durch regelmäßige Informationen über die Projekte und Bedarfe kostenfrei eigene Öffentlichkeitsarbeit aktiv zu übernehmen. Es überträgt dem CO die Verantwortung, die Unterstützung der Interessengruppen zu gewinnen und dazu beizutragen, die Vertrauensbewertung ihres Projekts zu verbessern. Schließlich ermöglicht es Stakeholdern, einschließlich Spendern, der Organisation schnelles Feedback zu geben. Die Zugänglichkeit und Einfachheit der Website ermöglichen es jeder Gruppe, egal wie klein, eine Präsenz und eine Bewertung zu entwickeln. Jeder kann sich anmelden, um Geld zu erhalten, und sobald eine Gruppe zehn Fürsprecher für die Website rekrutiert hat, ist sie berechtigt, Spenden zu erhalten, und unterliegt den Bewertungen anderer Benutzer. Die Website wurde entwickelt, um kleinen COs, die kein Budget für internationales Marketing haben, Sichtbarkeit und Fundraising-Macht zu geben. Tills Team greift zwar nicht in die markteigene Bewertung der Projektqualität ein, stellt aber sicher, dass die teilnehmenden COs definierbare soziale Ziele haben. Darüber hinaus ergreift Till weitere Maßnahmen, um Hindernisse zu beseitigen, die kleine Benutzer daran hindern könnten, kleine Beträge zu spenden. betterplace überweist Spenden zu 100 Prozent an die jeweiligen COs und schöpft keine Gelder ab. Till hat dies auf zwei Arten erreicht: Erstens finanziert er die Betriebskosten von betterplace über seine Einnahmen generierende Website, den Service, den er Unternehmen gegen Gebühr anbietet. Dies zahlt für Gehälter und Gemeinkosten. Zweitens ermöglicht er internationale Geldüberweisungen ohne Bankgebühren. Er hat mit der Bank BNP-Paribas ausgehandelt, dass sie Spenden über betterplace ohne Wechselgeld überweist. Angesichts der Neuartigkeit dieses Abkommens wurde Till eingeladen, an Gesprächsrunden mit der deutschen Regierung zum Thema Geldüberweisungen teilzunehmen. Till plant, 60 bis 70 Prozent seines Betriebsbudgets durch seine Arbeit mit Firmenkunden aufzubringen, und verbringt die meiste Zeit damit, neue Kunden zu werben und Verträge mit interessierten Unternehmen auszuhandeln. Die durch dieses Geschäft gesammelten Mittel werden es ihm ermöglichen, seinen Programmiererstab und seine Serverkapazität zu erweitern, um der wachsenden Zahl von betterplace-Benutzern gerecht zu werden. Um nicht in Abhängigkeit von wenigen Großkonzernen zu geraten, ist er auch mit einigen mittelständischen Unternehmen im Gespräch über Corporate-Responsibility-Projekte. betterplace.org arbeitete zunächst in Büros, die Daimler ehrenamtlich gespendet hatte, aber Till hat betterplace.org inzwischen in einen eigenen Raum verlegt – auch hier, um die Abhängigkeit von einem einzigen Unternehmenspaten zu vermeiden.
Till Behnke Till Behnke