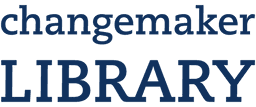Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Michaela NachtrabDeutschland • VerbaVoice
Ashoka-Fellow seit 2011
Ashoka-Fellow seit 2011
Michaela Nachtrab stellt sich eine Gesellschaft vor, in der Barrierefreiheit für hörbehinderte und gehörlose Bürger eher die Regel als die Ausnahme ist. Das bedeutet nahtlose Kommunikation im Bildungs- und Berufsumfeld sowie Zugang zu Informationen, Veranstaltungen und allen Arten von Medien. Michaela stellte VerbaVoice als Plattform vor, um eine selbstorganisierte Gemeinschaft von Gehörlosen und Schwerhörigen zu starten, die eine aktive Rolle bei der Förderung der Barrierefreiheit und ihrer eigenen Teilhabe an der Gesellschaft übernehmen kann.
Die Person
Michaela arbeitet seit 1993 mit Hörgeschädigten. Sie hat Gehörlosenpädagogik studiert und war mehr als acht Jahre in der Rehabilitation tätig, baute und leitete als Regionalleiterin mehrere lokale Niederlassungen für eines der größten Rehabilitationsunternehmen für Hörgeschädigte in Deutschland. Michaela erlebte aus erster Hand die tragischen Engpässe bei der Transkription für Hörgeschädigte. Seit 2002 arbeitet Michaela nebenberuflich als Gebärdensprachdolmetscherin. Außerdem hat sie eine Informationsplattform rund um Finanzierungsmöglichkeiten von Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte aufgebaut und Nachtrab Social Affairs, einen Verein zur Förderung von Projekten mit sozialer Wirkung, gegründet. Als Folge dieser Aufgaben – die sie sowohl als Projektmanagerin als auch als Gebärdensprachdolmetscherin einbezog – wurde sie unzufrieden mit der großen Lücke in der Versorgung der Gemeinschaft der Gehörlosen und Schwerhörigen – der geringen bis gar keinen Aufmerksamkeit, die Schwerhörigen gewidmet wird oder gehörlose Bürger, die keine Gebärdensprache beherrschten. Michaela begann die Idee von VerbaVoice als Verschmelzung von sozialen und technischen Lösungen zu entwickeln und engagierte sich bald dafür. Michaela hatte sich bisher vorgenommen, ihre Masterarbeit nur dann abzuschließen, wenn sie ein Thema gefunden hatte, das ihre Arbeit relevant, anwendbar und mehr als nur einen Gegenstand im Bücherregal machen würde. 2008 schloss sie ihr Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Social Entrepreneurship ab. Die Stakeholder-Analyse in Michaelas Abschlussarbeit bildet die Grundlage für den Businessplan von VerbaVoice.
Die neue Idee
Über 75 Prozent der gehörlosen und hörgeschädigten Bürger in Deutschland kennen keine Gebärdensprache und verlassen sich auf persönliche Transkriptionsunterstützung von Stimme zu Text. Die hohen Kosten und die begrenzte Verfügbarkeit dieses Dienstes verringern ihre Chancen auf schulischen und beruflichen Erfolg erheblich. Gleichzeitig wird eine bezahlbare automatische Spracherkennungstechnologie die erforderliche Qualität nicht in den nächsten zwanzig Jahren liefern können. Mit VerbaVoice baut Michaela eine zweistufige Architektur auf, um dieses Problem zu überwinden: Sie leistet Pionierarbeit bei einem webbasierten Dienst, der die Kosten für Transkriptionsdienste drastisch senkt, und baut darüber hinaus die Kommunikationsplattform auf, die gehörlosen und schwerhörigen Bürgern ermöglicht eine aktive Rolle bei der Beendigung ihrer Ausgrenzung zu übernehmen. Michaelas Bemühungen haben sich über ganz Deutschland ausgebreitet und werden sich in den kommenden Jahren auf ganz Europa ausdehnen. Ein grundlegender Baustein ist Michaelas marktbasierte Lösung für allgegenwärtige Transkriptionsdienste. Mit der Online-Plattform von Michaela kann eine hörgeschädigte Person bei Bedarf einen Transkribierer buchen und sich mit ihm verbinden. Die Stimme des Sprechers wird von einem Laptop oder Mobiltelefon aufgenommen, in Echtzeit von einem von zu Hause aus arbeitenden Transkriptor transkribiert und auf dem Bildschirm des Laptops oder Telefons angezeigt. Dieses System reduziert die Kosten um 35 Prozent und bietet Hörgeschädigten einen weitgehend verfügbaren und erschwinglichen Transkriptionsdienst für berufliche, schulische und private Anlässe. Über ihren Kerndienst hinaus erkennt Michaela das Potenzial für eine breitere soziale Anwendung von Voice-to-Text-Berichterstattung: Ihr Transkriptionsdienst kann als Grundlage für eine zweite Ebene der Ermächtigung und Integration von hörgeschädigten und gehörlosen Bürgern dienen. Die begünstigte Gemeinschaft kann den sozialen Wert der Dienstleistung durch zahlreiche Initiativen konkretisieren. Begünstigte können die Untertitelung von Nachrichten oder Filmen für die Community oder die Öffentlichkeit per Crowdfunding finanzieren. Oder sie können jedem, unabhängig von seinem Hörstatus, die Möglichkeit geben, an öffentlichen Veranstaltungen online per Transkript teilzunehmen und diese zu verfolgen – kostenlos oder zu minimalen Kosten. Die Community-Plattform auf VerbaVoice ermöglicht es den Begünstigten auch, Kampagnen zu organisieren und Rankings von Unternehmen und Universitäten zu erstellen und zu veröffentlichen, die Transkriptionstools am effektivsten integrieren.
Das Problem
Michaela arbeitet an der Bekämpfung eines zweifachen Problems, das die gehörlose und schwerhörige Gemeinschaft in Deutschland betrifft: (i) Obwohl die Transkription ein unverzichtbares Werkzeug für die Kommunikation ist, ist sie nicht zugänglich und kostengünstig, und (ii) hörgeschädigten Bürgern wird dies verweigert eine aktive Rolle bei der Integration in die breitere Bevölkerung. 300.000 Deutsche (und 40 Millionen Menschen weltweit) sind hochgradig hörgeschädigt, was zu ihrer sozialen und wirtschaftlichen Ausgrenzung führt. Ihre Arbeitslosenquote ist deutlich höher und ihre durchschnittlichen Gehälter viel niedriger als die von hörenden Personen. Derzeit gibt es drei Möglichkeiten für eine hörgeschädigte Person, verbal zu kommunizieren: Lippenlesen, Gebärdensprache und Transkription. Nur 20 Prozent der Bedeutung in der Kommunikation lassen sich von den Lippen ablesen; die restlichen 80 Prozent müssen abgeleitet werden. Zudem versteht nur ein Viertel aller Hörgeschädigten in Deutschland (80.000 Menschen) Gebärdensprache, Tendenz steigend, da ältere Erwachsene schwerhörig werden, aber keine Gebärdensprache mehr lernen. Auch die Verbreitung der Gebärdensprache wird weiter abnehmen, da immer mehr gehörlose Kinder Cochlea-Implantate erhalten, die die Hörwahrnehmung wiederherstellen, das Kind aber zwischen Gehörlosen und Hörenden hin- und hergerissen zurücklassen. Auch wenn die Transkription die effektivste Lösung für diese Kommunikationsherausforderungen von Gehörlosen und Schwerhörigen ist, ist sie schwer zugänglich: Nur 10 Prozent der deutschen Fernsehsendungen haben Untertitel und nur sehr wenige öffentliche Veranstaltungen, Seminare, Vorträge oder Kurse bieten eine Transkription an Dienstleistungen. Die Verfügbarkeit der persönlichen Transkription ist sogar noch eingeschränkter. Persönliche Transkriptionsunterstützung erfordert einen professionellen Transkriptor, der die hörgeschädigte Person zu Vorträgen, Geschäftstreffen, Vorstellungsgesprächen und ähnlichen Anlässen begleitet. Der Transkriptor wandelt dann gesprochene Kommunikation in schriftliche Form um. Die Kosten dieser Dienstleistung sind für die Sozialversicherungssysteme und die einzelnen Kunden erheblich. In Bayern beispielsweise, dem größten Bundesland Deutschlands, gibt es derzeit eine aktive Schreibkraft. Transkriptoren müssen mit ihren Kunden reisen und werden zusätzlich zu den Reisekosten stundenweise bezahlt, was den Service sehr teuer macht. Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler und Ingenieure, vollautomatische Spracherkennungssysteme zu entwickeln. Bis heute ist jedoch keine automatische Lösung vollständig für Hörgeschädigte nutzbar und selbst Marktführer wie IBM, Fraunhofer-Institute oder Nuance schätzen, dass ein einsatzfähiges System etwa zwanzig Jahre entfernt ist. Die grundlegende Herausforderung besteht darin, gleichzeitig eine Lösung bereitzustellen, die jede Stimme und ein breites Vokabular versteht und dies in Echtzeit tun kann. Neben finanziellen und technischen Hindernissen wird hörgeschädigten und gehörlosen Bürgern eine aktive Rolle bei der Lösung dieser misslichen Lage verwehrt. Sie sind es gewohnt, Empfänger öffentlicher Unterstützungsleistungen zu sein, aber die sehr individuelle Bereitstellung von Unterstützung hat es schwierig gemacht, diese Ressourcen innerhalb der Gemeinschaft breit zu verteilen. Das öffentliche Bewusstsein für dieses Ausgrenzungsproblem ist ebenfalls minimal, was den Mangel an Integration zwischen den Gemeinschaften hörender und nicht hörender Personen verstärkt.
Die Strategie
Michaelas Strategie basiert auf einer Kombination aus ihrem Online-Service und seinem Potenzial für soziales Handeln, die eine ermächtigende Architektur für Barrierefreiheit erzeugen. Mit ihrer Marktlösung hat Michaela die richtigen Bausteine für einen neuartigen Online-Conferencing-Service kombiniert: Die Stimme des Sprechers wird an eine zentrale Stelle übertragen, wo der Transkriptor den Inhalt Wort für Wort für eine Spracherkennungssoftware „umstimmt“. wird speziell für seine Stimme trainiert. Die Software überträgt die gesprochenen Worte in schriftliche Form. Insbesondere hier entwickelt Michaela die Spracherkennungstechnologie nicht selbst, sondern kann auf Produkte von der Stange zurückgreifen, da ihr Customizing und das individuelle Stimmtraining Standardprodukte schnell genug machen. Das macht sie auch unabhängig von bestimmten Softwareprodukten. Mit fortschreitender Technologie in der Zukunft wird Michaela in der Lage sein, neue Softwarelösungen einzubinden. In diesem Sinne ist sie eher Online-Convenor denn technischer Dienstleister. Der Text wird dann mit minimaler Zeitverzögerung auf ein Display vor dem Kunden auf einem Handy oder Computer übertragen. Die Online-Plattform von Michaela ermöglicht es Hörgeschädigten, Online-Transkriptoren kurzfristig zu buchen. Sie arbeitet derzeit mit zwanzig Transkriptoren zusammen, arbeitet jedoch mit bestehenden Buchungsagenturen zusammen, die hörgeschädigten Bürgern Transkriptoren anbieten, um Doppelarbeit zu vermeiden. Der größte Teil der 35-prozentigen Kostensenkung, die Michaela durch diese Plattform bereits erreicht hat, ist das Ergebnis des Designs, das es Transkribenten ermöglicht, aus der Ferne zu arbeiten. Transkriptoren können Aufträge annehmen, die zuvor aufgrund von Reisezeiten und anderen logistischen Hindernissen nicht ausgeführt werden konnten. Die Online-Plattform ermöglicht vielen Transkriptoren, die Teilzeit arbeiten oder selbst behindert sind, von zu Hause aus zu arbeiten. Schließlich vereinfacht es das komplexe Abrechnungssystem für den Transkriptionsdienst. Die Einnahmen von VerbaVoice stellen einen Teil dieser Erstattungen bereit. Im Jahr 2010 hat VerbaVoice ungefähr 50 Kunden 900 Stunden Transkriptionsdienste bereitgestellt. Die Marktlösung von Michaela hat ein enormes Potenzial, das über die bloße Bereitstellung einer Dienstleistung hinausgeht. Michaela arbeitet zum Beispiel daran, eine Bibliothek mit „Stimmprofilen“ für Universitäten und Unternehmen aufzubauen. Mit Hilfe dieser individuellen Profile von Sprechern, für die Sprecher die Software einige Stunden trainieren müssen, kann die Software mündliche Kommunikation direkt transkribieren, ohne einen Re-Voicing-Transkriptor zu verwenden. Wenn die meisten Universitätsprofessoren oder die wichtigen Arbeitskollegen eines hörgeschädigten Menschen solche Profile hätten, wäre eine Transkription basierend auf automatischer Spracherkennung sofort verfügbar – und zu noch geringeren Kosten. Damit wird aus einer technischen Herausforderung eine Chance für soziales Handeln: Die Community der Nutzer kann jetzt Kampagnen organisieren, um Familie, Freunde, Kollegen und Lehrer davon zu überzeugen, Sprachprofile zu erstellen und sich und ihre Organisationen „zugänglich“ zu machen. Außerdem könnte die Community die am besten zugänglichen Unternehmen nach der Anzahl der von ihnen erstellten Sprachprofile einstufen. Michaela plant, ihren Dienst für Gebärdensprachdolmetscher (unter Einsatz von Online-Videotechnologie) auf die Gruppe der Hörgeschädigten auszudehnen, die keine geschriebene Sprache verstehen. Unabhängig davon, wie die Transkriptionsmethoden für ihre Marktlösung funktionieren, eröffnen Michaelas Plattformen zahlreiche Möglichkeiten des sozialen Handelns. Beispielsweise soll die Plattform helfen, Freiwillige und Sponsoren zu sammeln, die kostenlose oder kostengünstige Transkriptionszeiten für private Anlässe (einschließlich Partys, Hochzeiten oder Beerdigungen) anbieten können, an denen Hörgeschädigte aufgrund fehlender Versicherungen sonst nicht teilnehmen könnten Abdeckung. Darüber hinaus kann die Plattform Crowdfunding für die Echtzeit-Untertitelung von Nachrichten, einem Film oder einer Fernsehsendung ermöglichen, da es zu teuer wäre, die Transkription für diese Medientypen einzeln zu bezahlen. Schließlich kann die Plattform genutzt werden, um bekannt zu geben, welche öffentlichen Veranstaltungen (Vorträge oder Konzerte) bereits mit einer Transkription gebucht wurden. Jedes Community-Mitglied kann entweder online oder persönlich beitreten. Ähnlich wie Online-Mapping-Plattformen, die die Zugänglichkeit von Gebäuden für Rollstühle zeigen, wird dies Hörgeschädigte stark dazu ermutigen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich als aktive, gleichberechtigte Bürger zu engagieren. Michaela plant, mit den großen Verbänden sowie den wichtigsten Online-Hubs für Gehörlose und Hörgeschädigte zusammenzuarbeiten. Neben ihrer Technologie- und Community-Entwicklung ist Michaela auf politischer Ebene aktiv. Sie arbeitet mit dem Bayerischen Landtag zusammen, um Transkriptionsdienste für alle Parlamentsdebatten sicherzustellen. Damit setzt sie nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention richtig um, sondern verschafft ihrem Engagement auch mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Künftig wird Michaela dies auch auf andere Parlamente übertragen und ihre Lobbyarbeit ausbauen.
Michaela Nachtrab