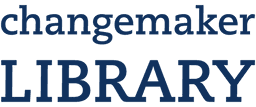Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Klaus CandussiÖsterreich • atempo
Ashoka-Fellow seit 2014
Ashoka-Fellow seit 2014
Die Person
Als eines von fünf Kindern in einer Familie mit bescheidenen finanziellen Verhältnissen aufgewachsen, lernte Klaus schnell, dass das Erreichen höherer Ziele oder Wünsche besonderer Eigeninitiative bedarf. Klaus wurde sowohl in der Schule als auch in der Universität in die Rolle des Schülervertreters gewählt. Nach dem Studium der Musikwissenschaft absolvierte er einen Zivildienst bei der Behindertenorganisation Lebenshilfe, wo sein Interesse für Behinderten- und gesellschaftliche Themen erstmals geweckt wurde. Klaus begann als Regionalleiter der Lebenshilfe, um die Organisation neu zu organisieren und zu professionalisieren. Er gründete auch eine profitable Zeitung für die Lebenshilfe, die zu ihrem zentralen Kommunikationsinstrument für Behindertenthemen wurde. Bei der Lebenshilfe trafen sich Klaus und Walburga zum ersten Mal. Als begeisterter Journalist – sowohl aus Leidenschaft als auch als Nebenbeschäftigung – engagierte sich Klaus Anfang der 1990er Jahre in der Psychiatrischen Klinik Graz im Kampf gegen die systemische Misshandlung behinderter Jugendlicher. Seine investigativen Artikel trugen dazu bei, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Als die steirische Landesregierung keine Lösungen zur Auflösung des „Gulag“, wie die psychiatrische Abteilung in einem amtsärztlichen Gutachten genannt wurde, fand, identifizierte Klaus in einem ehemaligen Richter einen an der Sache interessierten Verbündeten und gründete Alpha Nova, um die Jugendabteilung der Klinik zu übernehmen, zu schließen und alternative Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für die ehemaligen Patienten zu schaffen. Geschäftsführer Klaus holte Walburga an Bord, um den Sozialdienstzweig von Alpha Nova aufzubauen. Als Alpha Nova schnell zu einem großen und komplexen Dienstleister wurde, erkannte Klaus die Notwendigkeit weiterer Universitätsabschlüsse. Während er seine Aufgaben bei Alpha Nova beibehielt, schrieb er sich ein und schloss später mit einem Studium in Sozialmanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Obwohl das Management und die funktionale Arbeit bei Alpha Nova Maßstäbe für den Bereich der gemeindeintegrierten Dienste für Menschen mit Behinderungen setzten, half Walburga Klaus zu erkennen, dass dieses bestehende Umfeld niemals zu einer grundlegenden Veränderung der Lebensqualität für die Nutzer führen würde zielt darauf ab, zu ermöglichen. Entgegen dem damaligen Mainstream-Denken ließen sich die beiden eher vom angelsächsischen Menschenrechtsansatz zu Behinderungen als vom skandinavischen Wohlfahrtsstaatsmodell inspirieren. Angesichts der Ideen der Selbstvertretungsbewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen beschlossen Walburga und Klaus, eine neue Institution – Atempo – als Ort zu gründen, an dem der beabsichtigte Wandel hin zu wertgeschätzten Rollen in der Gesellschaft und inklusiver Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne erreicht werden soll Behinderungen könnten praktisch passieren.
Die neue Idee
Walburga und Klaus schaffen Chancengleichheit für Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten. Sie zielen darauf ab, die Art und Weise, wie staatliche und private Stellen Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten einbeziehen und ihnen helfen, grundlegend zu verändern und dabei die Art und Weise zu verändern, wie die Gesellschaft ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial wahrnimmt. Im Mittelpunkt ihrer Strategie steht die Befähigung von Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten, eine Führungsrolle bei der Definition der Zugänglichkeit der Umgebung, in der sie leben, und der Qualität und Art der Pflege, die sie erhalten, zu übernehmen. Traditionell wurden diejenigen, die unter schweren Lernschwierigkeiten leiden, nicht in die Definition oder Entwicklung der Dienstleistungen einbezogen, die sie erhalten. Dies führte zu einem grundlegenden und chronischen Missverhältnis der erbrachten Leistungen. Tatsächlich sind Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten oft in einem Zustand der Abhängigkeit von staatlicher Fürsorge oder in der Inaktivität gefangen, was ihre Fähigkeit, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, stark einschränkt. Laut Walburga und Klaus sollte das institutionelle Pflegesystem für Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten auf die Bedürfnisse, Perspektiven und Interessen derjenigen eingehen, denen es dienen soll. Die Vision von Walburga und Klaus ist es, eine Kehrtwende im vorherrschenden Top-down-System für Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten herbeizuführen, indem sie sie befähigen, ihr Leben selbst zu kontrollieren und zu entscheiden. Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten gewinnen ihre Stimme zurück. Sie erhalten Zugang zu entscheidenden Informationen, die es ihnen ermöglichen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und somit ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie sind mit Instrumenten ausgestattet, um die von ihnen erhaltenen Dienstleistungen zu bewerten, zu entscheiden und zu kontrollieren sowie die Barrieren zu bewerten und anzugehen, mit denen sie in der Mehrheitsgesellschaft fertig werden müssen. Dazu gehört es, vollen Einfluss auf die Einrichtungen zu erlangen, in denen sie betreut werden, stationäre oder ambulante Einrichtungen zu wählen, das System zu verlassen und alleine zu leben und schließlich die vielfältigen Barrieren niederzureißen, die sie in der Mainstream-Gesellschaft umgeben. Walburga und Klaus schaffen eine Bottom-up-Community der Peer-to-Peer-Unterstützung und -Einflussnahme, so dass nach und nach mehr ehemalige Klienten von Ganztagsbetreuungsdiensten zu gegenseitigen Experten für ihre Altersgenossen werden. Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten werden zu Experten, die den institutionellen Wandel und barrierefreie Landschaften vorantreiben. Diese Vision wird sowohl in bestimmten institutionellen Kontexten als auch durch Beeinflussung des Systems auf Provinz- und nationaler Ebene verwirklicht, indem die alten, traditionellen, entmachtenden Strukturen durch den neuartigen Peer-to-Peer-Ansatz ersetzt werden.
Das Problem
Laut Europäischer Kommission hat ein Prozent der Bevölkerung dauerhafte Lernschwierigkeiten. In Österreich und Deutschland erhalten 20-30 Prozent eine ganztägige Betreuung in Form von Betreutem Wohnen (Betreutes Wohnen) oder Betreutes Arbeiten (Betreutes Arbeiten). Das bedeutet, dass der Lebensstil von jedem fünften Menschen mit Lernschwierigkeiten vollständig von sozialen Diensten abhängt, deren Bereitstellung sich oft über das ganze Leben erstrecken kann. Auch diejenigen, die nicht in einem vollzeitlich betreuten Wohn- oder Arbeitsumfeld leben, sind (wenn auch nicht so stark) auf staatliche Sozialleistungen angewiesen. Experten zufolge könnten 20 Prozent der Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in Österreich institutionalisierte Leistungen erhalten, möglicherweise bereits jetzt alleine leben und arbeiten und daher sofort aus dem institutionalisierten Betreuungssystem aussteigen. Weitere 30 Prozent könnten mittelfristig durch eine begleitete Übergangsphase von der institutionellen Pflege in das Betreute Wohnen wechseln. Die Gesellschaft nimmt Personen mit schweren Lernschwierigkeiten als unfähig wahr, begründete Meinungen zu ihren eigenen Bedürfnissen oder Interessen abzugeben. Sie gelten weitgehend als passive Leistungsempfänger. Wenn überhaupt, werden nur nahe Angehörige um Feedback zur Qualität der erhaltenen Leistungen gebeten. In dem seltenen Fall, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, die institutionalisierte Angebote erhalten, direkt befragt werden, werden sie von nichtbehinderten Experten und nur nach ihrer subjektiven Zufriedenheit befragt; ihr nutzerbasiertes Fachwissen wird weder anerkannt noch ausgenutzt. Typischerweise sind die versandten individuellen Zufriedenheitsumfragen weder für die Bewertung des Output- und Ergebnisniveaus der erbrachten Dienstleistungen geeignet, noch ermöglichen sie ein qualitatives Benchmarking von Dienstleistungseinrichtungen, da es an messbaren Kriterien und Transparenz mangelt. Das bedeutet, dass Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten eine Betreuung erhalten, die nicht ihren tatsächlichen Bedürfnissen entspricht. Dennoch wird die Mehrheit der Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten in institutionelle Betreuung gegeben. In den extremsten Fällen werden sie in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen, die ihre grundlegenden Menschenrechte missachten. Eine Voraussetzung dafür, dass sich Menschen mit schwerer Lernbehinderung frei in der Gesellschaft bewegen können, ist, dass sie die Sprache und narrativen Codes der Gesellschaft verstehen, in der sie sich bewegen. Aber das gilt nicht nur für sie. Basierend auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen verfügen 40 Prozent der europäischen Gesamtbevölkerung über eine Lese- und Schreibkompetenz von A2, können also nur einfache Texte lesen und verstehen. Allerdings kommunizieren 70 Prozent der öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen auf dem Niveau C1. Daher versteht fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung wichtige Alltagsinformationen kaum und kann nicht voll am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dieser Mangel an angemessener Bildung (funktionaler Analphabetismus) und Zugang zu Informationen wirkt sich allein in Österreich und Deutschland negativ auf 30 Millionen Menschen aus. 2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen die „Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihr Fakultativprotokoll“, die 2008 von Österreich ratifiziert wurde. Die Konvention besagt, dass Menschen mit Behinderungen die Freiheit haben sollen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sowie die Möglichkeit, aktiv an Entscheidungsprozessen über Richtlinien, Programme und Mechanismen beteiligt zu sein, einschließlich derjenigen, die sie direkt betreffen. Bisher gab es keine systematische Rückkopplungsschleife, um die Erfahrungen der Endbenutzer im Reformprozess für institutionelle Pflegesysteme zu aggregieren, zu analysieren und zu kommunizieren. Darüber hinaus hindern zahlreiche Barrieren immer noch Menschen mit Behinderungen und andere gefährdete Gruppen daran, die volle Staatsbürgerschaft in der Mainstream-Gesellschaft zu verwirklichen.
Die Strategie
Walburga und Klaus haben einen Traum, dass alle Menschen mit Behinderungen und Schwierigkeiten ein selbstbestimmtes Leben führen können. Der erste Schritt besteht darin, ein Pflegesystem zu schaffen, das sich aus der Beteiligung seiner Nutzer, der behinderten Menschen selbst, entwickelt, indem es ihnen ermöglicht wird, ihre Bedürfnisse zu äußern, aktiv zur Änderung bestehender Praktiken beizutragen und die Art und Weise zu wählen, wie sie leben möchten. Walburga und Klaus bilden Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten zu Experten aus, die die vollstationären Betreuungsangebote von Einrichtungen in Form von Betreutem Wohnen (Betreutes Wohnen) oder Betreutes Arbeiten (Betreutes Arbeiten) beurteilen und bewerten. Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten werden als Gutachter und Change Manager in Pflegeeinrichtungen ausgebildet und eingesetzt. Sie lernen Qualitätskriterien zu entwickeln, Interviews zu führen und erhaltene Daten zu analysieren. Am wichtigsten ist, dass diese Gutachter über die unschätzbare Erfahrung verfügen, in geschützten und vollständig betreuten Pflegeeinrichtungen gelebt und gearbeitet zu haben. Die Gutachter entwickeln die Qualitätskriterien gemeinsam mit den Nutzern, d. h. Patienten, von Pflegeeinrichtungen, führen die Interviews durch und präsentieren die Ergebnisse. Sie bilden Nutzerinnen und Nutzer von Pflegeeinrichtungen zu Qualitätsmanagern in ihrer eigenen Einrichtung aus, um den Change-Management-Prozess zu leiten. Diese Peer-to-Peer-Begegnung auf Augenhöhe ist eine transformative und stärkende Erfahrung. Die Bewerter fühlen sich kompetent, gebraucht, selbstbewusst und als Teil einer größeren Bewegung, um das Leben anderer zu verändern, die ihre Lernschwierigkeiten teilen. Sie ziehen ihre Arbeitszufriedenheit aus der Tatsache, dass sie Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten befähigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren, und dass sie einen richtigen Job haben, der ihnen Zugang zu Einkommen und einem unabhängigeren Lebensstil ermöglicht. Sie fungieren als Vorbilder für ihre Peers (die Befragten, also Nutzer), die Perspektiven wechseln, Vertrauen gewinnen und neue Vorstellungen davon entwickeln, wie sie ihr Leben wirklich leben wollen und welche Möglichkeiten sie haben. Die behinderten Bewohner werden befähigt, gemeinsam den institutionellen Qualitätsbalken zu definieren und die Status-quo-Leistung der Einrichtung zu beurteilen. Bei Abweichungen ist eine Änderung erforderlich. Dies ermöglicht die nächste Ebene der Ermächtigung. Entweder ändert sich die Institution oder die Menschen wechseln die Institution. Ersteres setzt voraus, dass ausgewählte behinderte Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen zu Change Managern ausgebildet werden. Change Manager werden von diesen Einrichtungen eingestellt, arbeiten mit dem Pflegepersonal zusammen und steuern gemeinsam den Übergangsprozess zur Verbesserung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen. Der behinderte Change Manager ist der Vermittler zwischen dem „behinderten“ Management und den „behinderten“ Benutzern und garantiert, dass die Perspektive des Benutzers die Institution formt und erneuert. Walburga und Klaus haben eine Online-Plattform entwickelt, die alle Evaluationsergebnisse öffentlich macht. Personen mit Lernschwierigkeiten, ihre Angehörigen, Dienstleister, öffentliche Einrichtungen und Experten können die Ergebnisse vergleichen und die besten Orte und Praktiken auswählen. Dadurch wurde ein transparenter öffentlicher Zugang zu benutzerbasierten Informationen über Dienstleistungseinrichtungen für Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten in der Welt geschaffen. Es ist ein enormer Ansporn für Dienstleister, die Evaluationsergebnisse ernst zu nehmen und ihre Dienstleistungen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Dienstleister müssen ihre Praktiken ändern, wenn sie ihren Ruf, ihre Finanzierung und letztendlich ihre Kunden nicht verlieren wollen. Die Online-Plattform zeigt aktuell 658 bewertete und vergleichbare Dienstleister. Das Land Steiermark hat sein Modell bereits übernommen, um sein institutionelles Betreuungssystem für Menschen mit schweren geistigen Beeinträchtigungen neu zu gestalten. Andere Bundesländer in Österreich und Deutschland folgen nun diesem Beispiel und leiten gesetzliche und politische Änderungen ein, um das Modell oder bestimmte Elemente davon zu übernehmen, wie die österreichischen Bundesländer Oberösterreich und Tirol oder die deutschen Bundesländer Berlin und Hamburg. Durch dieses Modell helfen Walburga und Klaus Dienstleistern, ihre Dienstleistungen zu verbessern, öffentlichen Einrichtungen, reaktionsfähige Richtlinien und Unterstützungsmaßnahmen zu entwerfen, öffentliche Gelder effizienter zuzuweisen und Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es ist ein einzigartiger Mechanismus, der es Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten ermöglicht, das institutionelle Pflegesystem gemäß ihren Bedürfnissen und Perspektiven zu gestalten und zu verändern, mit dem ultimativen Ziel, ein freies Leben in der Mainstream-Gesellschaft zu führen. Der von Walburga und Klaus angestoßene Evaluations- und Veränderungsprozess zeigt das gesamte Spektrum bestehender Betreuungsmöglichkeiten für behinderte Menschen auf, d.h. nicht institutionalisierte Teilzeitpflege. Viele behinderte Menschen entscheiden sich nicht nur dafür, die Institution zu wechseln, sondern gewinnen ihr Selbstvertrauen und ihre Fähigkeit zurück, das institutionalisierte Betreuungssystem überhaupt zu verlassen – oder entwickeln den Wunsch, es zu verlassen. Damit steigt zugleich die Nachfrage nach dem – vergleichsweise günstigeren – nicht institutionalisierten Teilzeit-Fördersystem. Die durchgeführten Evaluationsergebnisse und Einschätzungen werden von Walburga und Klaus genutzt, um Entscheidungsträgern aufzuzeigen, dass institutionalisierte Pflegesysteme grundlegend reformiert werden müssen und dass Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten Institutionen verlassen würden, weil ihnen ermöglicht wird, selbst zu wählen, wie sie leben möchten. Sie werben dafür, dass ein nicht institutionalisiertes Betreuungssystem aktiv aufgebaut werden muss, das vor allem auf der aktiven Teilhabe der Behinderten selbst beruht und ein freies Leben in der Mehrheitsgesellschaft garantiert. Daher organisieren Walburga und Klaus Konferenzen und Workshops, die behinderte Menschen als Experten für die Transformation des alten Pflegesystems fördern, was sowohl dem behinderten als auch dem nichtbehinderten Fachpublikum Vertrauen und Zuversicht vermittelt, dass ein solcher Bottom-up-Veränderungsprozess möglich ist. Die Kraft der Arbeit von Walburga und Klaus entfaltet sich erst dann, wenn ganze Bundesländer oder Regionen ihren Ansatz übernehmen. Wenn dies geschieht, entscheiden sich immer mehr behinderte Menschen dafür, das institutionelle Pflegesystem zu verlassen. Dies erhöht automatisch die Nachfrage nach mehr nicht institutionalisierten Teilzeit-Betreuungsoptionen. Und je mehr Menschen mit Behinderungen außerhalb von Institutionen leben, desto mehr ist es eine implizite Notwendigkeit, die Mauern und Barrieren in der Mehrheitsgesellschaft für Menschen mit Behinderungen niederzureißen. Deshalb wird ihr Ansatz zu einem tiefgreifenden Transformationsprozess, wenn er in geografische Regionen verdichtet wird. Erstens lösen sie einen Wandel in Institutionen und Denkweisen aus, sodass sich die traditionelle Pflegeinfrastruktur entsprechend den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen verändert und als Folge davon immer mehr Menschen mit Behinderungen das institutionalisierte Pflegesystem verlassen; Zweitens schaffen sie förderliche, reaktionsfähige und barrierefreie Landschaften für Menschen mit Behinderungen, die Lebensqualität in der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen. Walburga und Klaus arbeiten mit ganzen Regionen daran, barrierefrei und barrierefrei zu werden. In diesen Regionen arbeiten Walburga und Klaus mit Kommunen, Bürgerinitiativen und Unternehmen zusammen, um gemeinsame barrierefreie Visionen für ganze Regionen, Status-quo-Bewertungen und Roadmaps für den Wandel zu entwickeln. Der Veränderungsprozess wird über die Zeit überwacht und ein Zertifizierungssystem zeichnet Erfolge aus. Die Regionen selbst sind in ein breiteres nationales und internationales Netzwerk eingebunden, in dem sie ihre Erfahrungen austauschen können. An diesen Reformen beteiligen sich die Menschen mit Behinderungen wieder aktiv als Experten und ihre Rückmeldungen und Perspektiven prägen die regionalen Reforminitiativen. Regionale Akteure werden dadurch angeregt, dass ca. 10 % der Bevölkerung eine Schwerbehinderung haben und dieser Trend in den kommenden Jahren durch eine immer älter werdende Bevölkerung noch zunehmen wird. Dies stellt eine große, aber vernachlässigte Kundengruppe und Kaufkraft für die regionale Wirtschaft dar. So werden diese regionalen Barrierefreiheits-Initiativen oft vom kommunalen Tourismus, von Wirtschaftsförderungsgesellschaften und der lokalen Wirtschaft getragen. Darüber hinaus sensibilisieren Walburga und Klaus Unternehmen und Behörden dafür, dass die von ihnen produzierten und verbreiteten Unternehmens- und Öffentlichkeitsinformationen – von Gesetzestexten über digitale Medien zum Arbeitsschutz, Fragebögen, Website-Texte und vieles mehr – sein müssen übersetzt in eine einfache Sprache, die von der Mehrheit der Menschen in der Gesellschaft verstanden wird. Untersuchungen zufolge leiden 40 Prozent der europäischen Bevölkerung unter funktionalem Analphabetismus, der Hunderttausende Österreicher vom Alltag ausschließt oder zumindest ihr Leben enorm erschwert. Um diese Informationsbarrieren niederzureißen, arbeiten Walburga und Klaus mit Unternehmen und Behörden zusammen, um ihre Sprache zu ändern und letztendlich den narrativen Code der Mainstream-Gesellschaft zu ändern, die einen großen Teil ihrer Bevölkerung durch unfreiwillige Informationsbarrieren ausschließt. Walburga und Klaus bilden Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Korrektoren aus, die beurteilen, ob Informationen barrierefrei und leicht verständlich sind. Walburga und Klaus verbreiten ihre Ideen und Initiativen über ein preisgekröntes Social-Franchise-System. Das ultimative Ziel des Social-Franchise-Systems ist es, Arbeitsplätze für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu schaffen und gleichzeitig eine integrativere Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Das Social-Franchise-System bot einen intelligenten Mechanismus, um ihre Praktiken auf einfache Weise zu kodifizieren, damit andere Organisationen sie übernehmen und replizieren können. Es schafft ein Netzwerk von Praktikern, die Erfahrungen austauschen und die angebotenen Dienstleistungen weiterentwickeln. Vor allem schafft sie regionale, nationale und internationale Infrastrukturen zur Gestaltung von Pflegesystemen und barrierefreien Lebenswelten, die von den Menschen mit Behinderungen selbst getragen wird. Das wachsende Netzwerk wird zu einer mächtigen Bottom-up-Reformbewegung, einer Drehscheibe, die substanzielle Reformen in der Öffentlichkeit fördert und sich für diese einsetzt. Sie setzt sich nicht nur für abstrakte Reformen ein, die von gewöhnlichen Experten entworfen wurden, sondern entwickelt und artikuliert die Alternativen aus der Perspektive der Basis und der Menschen mit Behinderungen selbst. Walburga und Klaus stehen am Scheideweg einer großen Aufnahme ihrer Ideen. Nachdem sie über 10 Jahre damit gekämpft haben, diese neuen Perspektiven in das traditionelle System einzuführen und Wege zu finden, diese Ansätze von anderen Praktikern reproduzierbar zu machen, erfahren sie jetzt einen sanften Rückenwind. Das Netzwerk ist gewachsen, die Ergebnisse haben das Konzept bestätigt, und ein neues Pflegesystem ist im Entstehen, angetrieben durch Gesetzesreformen, die in mehreren Bundesländern in Österreich und Deutschland umgesetzt wurden. Auch die UN-Deklaration über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die in den letzten Jahren von Regierungen in ganz Europa verabschiedet wurde, hat ihren Reformkurs endlich offiziell anerkannt. Der traditionelle kulturelle Widerstand der letzten Jahre lässt nach. Ziel von Walburga und Klaus ist es, das Netzwerk in erster Linie europaweit zu verbreiten. Es wird zur intellektuellen und praktischen Infrastruktur eines von unten nach oben gerichteten und auf Behinderung ausgerichteten Reformprozesses, der die institutionelle Landschaft gemäß den Bedürfnissen und Perspektiven der behinderten Menschen selbst in ganz Europa verändern und gleichzeitig barrierefreie Landschaften schaffen wird, die es allen ermöglichen jede Art von „Behinderung“, sich in der Mainstream-Gesellschaft frei zu bewegen und zu leben. Darüber hinaus planen Walburga und Klaus, ihre Arbeit auf andere Sektoren, Institutionen und Zielgruppen auszudehnen. Der natürliche nächste Schritt besteht darin, ihre Arbeit für Senioren und Krankenhauspatienten im Rahmen von Pflegeheimen, Krankenhäusern und Rehabilitationszentren anzupassen. Über diese Felder hinaus wollen Walburga und Klaus ihr Modell im Kontext von Gefängnissen und Aufnahme- und Haftzentren für Migranten testen. Die Idee ist die gleiche wie für Menschen mit schweren Lernschwierigkeiten, d. h. die Nutzer zu befähigen, die Qualität der Dienstleistungen, die sie erhalten, zu beeinflussen, einen transparenten öffentlichen Zugang zu nutzerbasierten Informationen über Dienstleistungseinrichtungen zu ermöglichen und eine Bottom-up-Reformbewegung zu fördern .
Klaus Candussi Klaus Candussi Klaus Candussi