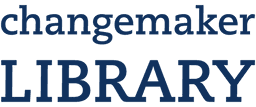Changemaker Library verwendet Cookies, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und die Leistung zu analysieren. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem Setzen dieser Cookies zu, wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben. Das Klicken auf "Ablehnen" kann dazu führen, dass Teile dieser Website nicht wie erwartet funktionieren.
Isidora RandjelovićDeutschland • Romnja* archive RomaniPhen
Ashoka-Fellow seit 2022
Ashoka-Fellow seit 2022
Isidora baut eine neue feministische Bewegung mit und für Roma-Frauen in ganz Europa auf, um nicht nur die Geschichte zurückzugewinnen, sondern auch Teil des Aufbaus der Zukunft zu werden. Diese neue Bewegung schreibt die Geschichte aus der Perspektive der Frauen neu und bereitet die jungen Roma-Frauen auf die Zukunft vor, indem sie sie mit den richtigen Werkzeugen und Mentoren ausstattet. Durch RomaniPhen schafft Isidora einen sicheren Raum für Roma-Frauen, um zusammenzukommen und ihren Platz in der Gesellschaft zurückzuerobern.
Die Person
Isidora wurde im ehemaligen Jugoslawien als Enkelin von Überlebenden des Faschismus geboren und wuchs mit viel Bewusstsein und Aufmerksamkeit für die Themen Ethnizität und Geschlecht auf. Als sie in der Grundschule nach Berlin zog, hat sie die meisten dieser Themen hautnah miterlebt. Trotz der Auseinandersetzung mit Migrantenproblemen wie sprachlichen und kulturellen Unterschieden musste sie auch rassistische Diskriminierung ertragen, wie z. B. die Unterbringung in einem separaten Klassenzimmer, Lehrer, die ihr rieten, Floristin zu werden (ein Beruf, der von den meisten Roma-Frauen unter schlechten Bedingungen ausgeübt wird) und von anderen Schülern gemobbt zu werden, weil sie eine dunklere Hautfarbe haben. Isidora meisterte diese Herausforderungen mit Hilfe ihrer Großeltern und ihrer engen Gemeinschaft und baute auch ein Bewusstsein für Klimaprobleme auf. Als ihr klar wurde, wie viel Müll der Kantinenraum verursachte, organisierte sie ihre erste Aktivisten-Veranstaltung. Sie überzeugte eine Gruppe von Kollegen, den ganzen Müll einzusammeln und ihn mitten in der Kantine zu lagern, um das Problem sichtbar zu machen. Mit dieser Veranstaltung hat sie nicht nur das Ziel erreicht, weniger Müll in der Mensa zu produzieren, sondern sich auch den Respekt und die Akzeptanz vieler anderer Studierender erworben. In ihrer Auseinandersetzung mit der historisch gewachsenen Verfolgung von Roma und Sinti und ihrem wachsenden Engagement in Bewegungen von Roma und Sinti lernte sie, dass die institutionellen Barrieren durch Gesetze, Routinen und Normen (re-)produziert werden, dahinter aber Menschen und ihre Interpretationen der Welt. Hier lernte sie, dass wir uns zwar für die Menschenrechte einsetzen, manche Menschen jedoch nicht gleichermaßen als Menschen anerkannt werden, nicht als Schöpfer, Fühler oder komplexe Personen mit persönlicher und kollektiver Geschichte. Also begann sie, an Prozessen der Wissensproduktion zu arbeiten, um zu lernen und der Entmenschlichung der Roma-Gemeinschaften entgegenzuwirken. Als sie ihre berufliche Laufbahn als Sozialarbeiterin begann, sah sie Entmenschlichung in Aktion. Auf sehr systematische Weise erhielten Roma-Migranten zusammen mit einigen anderen Gruppen, darunter Afrikaner, Araber usw., nur Zugang zu direkten Sozialhilfepaketen, während weiße Migranten zu psychologischer Hilfe und Berufskursen geführt wurden, was ihre Integration in die Mehrheit sicherstellen würde Gesellschaft im Laufe der Zeit. Roma- und Sinti-Kinder würden in schwierigen Situationen ganz anders behandelt als deutsche Kinder. Diese Erfahrung hat nicht nur ihr Vertrauen in das System erschüttert, sondern ihr auch klar gemacht, dass sie, um das System zu reparieren, zuerst das Denken der Mehrheit der Gesellschaft in ihrer eigenen Gemeinde ändern muss. Seitdem arbeitet sie an gemeinsamen Aktionen zur Förderung des gegenseitigen Lernens und der Reflexion zwischen Roma- und Nicht-Roma-Gemeinschaften.
Die neue Idee
Rassismus gegen Roma-Gemeinschaften ist in ganz Europa weit verbreitet und betrifft Frauen mehr als Männer. Trotz der doppelten Diskriminierung, der sie im Alltag ausgesetzt sind, werden Roma-Frauen aufgrund der stark patriarchalischen kulturellen Codes in ihren Gemeinschaften auch als zweitklassig angesehen. Weder die Rassismusproblematik noch das patriarchalische Paradigma wurden bis in die letzten Jahre richtig angegangen: Der deutsche Staat akzeptierte erst 1982, dass Roma auch Opfer von nationalsozialistischen Völkermorden waren. Obwohl Roma die zweithäufigste Opfergruppe des Holocaust waren (nach den europäischen Juden), werden ihre Verluste immer noch nicht in den Bildungsmaterialien oder Holocaust-Mahnmalen erwähnt. Roma-Kinder wuchsen auf, ohne die Folgen ihrer ethnischen Unterschiede, die Geschichte der Ereignisse oder die wichtigen Führer der Roma-Gemeinschaften zu kennen, ganz zu schweigen von den weiblichen Führern. Zusätzlich zu diesen historischen Problemen gibt es jetzt Neuankömmlinge in der Region, die nach dem Fall des Kommunismus dorthin ausgewandert sind. Diese neuen Roma-Gruppen kommen oft vom Balkan und haben nicht die gleichen Privilegien wie ihre Sinti-Kollegen (Sinti sind ein Zweig der Roma, der Deutsch sprechen kann und oft die Staatsbürgerschaft Deutschlands oder Österreichs besitzt). Es gibt sogar Vorfälle, in denen Balkan-Roma von Sinti diskriminiert werden, da diese Gemeinschaften oft unterschiedliche Sprachen, Religionen, kulturelle Normen usw. haben. Die in Jugoslawien geborene und in Deutschland aufgewachsene Feministin Isidora sieht in diesen vielen Konflikten eine Chance, Frauen zusammenzubringen eine feministische Agenda, trotz ihrer Unterschiede. Auf der ersten Ebene ihrer Arbeit zielt Isidora darauf ab, nicht nur die Geschichte der Roma aus der Perspektive von Frauen neu zu schreiben, sondern auch Roma-Frauen mit unterschiedlichen Geschichten zusammenzubringen, um an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, nämlich der Veränderung der vorherrschenden Erzählung über ihre Identität. Die Umschreibung der Geschichte ist für RomaniPhen von entscheidender Bedeutung und dringend, da die vorhandenen Ressourcen zu Romani, einschließlich ihrer Verluste während der Nazizeit, von Nicht-Roma oder Männern geschrieben wurden. Um dies zu erreichen, arbeitet RomaniPhen mit den am stärksten unterversorgten Roma-Frauen zusammen, um ihnen das Vokabular zu vermitteln, mit dem sie über ihre vergangenen und aktuellen Leiden sprechen können. Während diese Frauen mehr über das Patriarchat, systemischen Rassismus, Kolonialismus und Holocaust lernen; Sie erwerben Werkzeuge, um den Teufelskreis des Wissens über sie zu durchbrechen, das ohne sie produziert wird. RomaniPhen organisiert generationenübergreifende Räume, in denen Roma-Frauen zusammenkommen und ihre Geschichten teilen können. Die Ergebnisse dieser Geschichten werden dokumentiert und an relevanten Orten wie einem Holocaust-Mahnmal, Schulen, Kindergärten, Forschungsarbeiten usw. geteilt. Zusätzlich zu dieser Arbeit wendet sich RomaniPhen auch an bestehende Wissenschaftler und Fachleute mit Roma-Identität und gibt ihnen Raum, um über die Probleme von Roma-Frauen zu sprechen. Auf diese Weise nutzt Isidora die Macht bereits bestehender Roma-Frauenführerinnen, um Narrative zu verändern, und veranlasst sie, eine neue Sprache für die Belange von Roma-Frauen zu schaffen. Auf der zweiten Ebene zielt RomaniPhen darauf ab, die jüngeren Generationen dabei zu unterstützen, diese Bewegung fortzusetzen. Das erste Stück wird jungen Roma-Mädchen bereits Geschichten und Vorbilder liefern, um ihre Roma-Identität zu akzeptieren und dann mit diesem Wissen ihre Probleme zu bekämpfen. Isidora glaubt, dass diese Mädchen zusätzliche Ressourcen benötigen, damit sie in Zukunft Besitzer dieser Geschichten werden und ihr wahres Führungspotenzial in ihren Gemeinden ausleben können. Daher organisieren sie Workshops für diese jungen Mädchen, um Selbstvertrauen, Netzwerke und Fähigkeiten zu gewinnen, die ihnen helfen, sich auszudrücken (z. B. einen Podcast entwickeln, informative YouTube-Videos drehen). RomaniPhen hört hier nicht auf und wendet sich an die Lehrer der Schulen mit hoher Roma-Schülerdichte. Durch Workshops und Schulungen werden diese Lehrer für die Bedürfnisse ihrer jungen Roma-Schülerinnen in Bezug auf Mentoring und Coaching verfügbar. Angesichts der zunehmenden Diskussionen über Rassismus und Vielfalt organisiert RomaniPhen eine zeitnahe Reaktion, um allen Roma-Frauen in Europa die Staatsbürgerschaft zu bringen. Isidora dehnt sich auf bestehende Roma-geführte Gruppen aus und zielt darauf ab, diese Bewegung über den ganzen Kontinent zu verbreiten und das Denken und Erzählen der Mehrheitsgesellschaft sowie der Roma zu beeinflussen.
Das Problem
Schätzungen zufolge leben 15 bis 20 Millionen Roma in Europa und 150.000 derzeit in Deutschland. Nachdem Roma um das 14. Jahrhundert von Indien nach Europa eingewandert waren, wurden sie schon immer in unterschiedlichen Ausprägungen und Ausprägungen diskriminiert. Auf dem gesamten Kontinent kämpften Roma-Gemeinschaften bis Mitte des 20. Jahrhunderts gegen systemischen Rassismus und Sklaverei. In den 1930er Jahren war es den Roma gelungen, sich für die allgemeine Bildung einzuschreiben, sich am Stadtleben zu beteiligen und Eigentum zu besitzen. Mit dem Aufstieg der Nazi-Herrschaft auf dem halben Kontinent gingen all diese Errungenschaften jedoch während des Holocaust verloren. Es wird geschätzt, dass 500.000 Roma in Konzentrationslagern getötet wurden, was bedeutet, dass Roma nach den Juden die am zweithäufigsten besiedelte Gruppe sind, die unter den Völkermorden der Nazis leidet. Bis 1982 wurde dies nicht einmal von der Bundesregierung anerkannt. Aufgrund der mündlich überlieferten Natur der Gemeinschaft wurden vor/nach dem Völkermord keine schriftlichen Beweise hinterlassen. Auch nach seiner Anerkennung wird das Thema noch immer nicht in den Schulen gelehrt oder an den meisten Holocaust-Denkmälern nicht erwähnt. Sinti (deutschsprachiges Romani) fühlten sich ungehört und ungesehen und wurden enttäuscht. Gleichzeitig kommen täglich neue Roma-Gemeinschaften nach Deutschland, meist aus dem Balkan und Mittelosteuropa. Diese Gemeinschaften unterscheiden sich von Sinti, wie z. B. die Sprache, die sie sprechen, die Religion, die sie praktizieren, und die kulturellen Normen, an die sie glauben. Während Sinti in Deutschland offiziell den Status einer Minderheit haben, haben die meisten dieser neu hinzugekommenen Roma in den Augen der Sinti keinen Status dem Staat, was bedeutet, dass sie keinen Zugang zu Minderheitenleistungen und -rechten haben. Zudem werden die Neuankömmlinge aufgrund ihrer kulturellen Unterschiede von ihren gleichaltrigen Sinti diskriminiert, was die Zusammenhalts- und Zusammenarbeitsfähigkeit der Gemeinschaft mindert. Diese Situation betrifft unverhältnismäßig viele Roma-Frauen und -Mädchen, die mit strukturellen Ungleichheiten (sozial, kulturell, wirtschaftlich) konfrontiert sind, die sie daran hindern, eine aktive gesellschaftliche Rolle zu übernehmen. Es gibt nur sehr wenige von Roma-Frauen geschriebene Wissensartikel über ihre Erfahrungen und spezifischen Herausforderungen. Die meiste Literatur wird entweder von Roma-Männern oder Nicht-Roma-Leuten geschrieben, die sich ihrer Perspektive entziehen und die Identität von Roma-Frauen über Jahrhunderte ausgelöscht oder herabgesetzt haben. Diskriminierung hat den Roma-Frauen ständig die persönliche Entwicklung, das Selbstwertgefühl, menschenwürdige Lebensbedingungen, Möglichkeiten zum Lebensunterhalt und institutionelle Dienstleistungen verweigert. Über die ausgrenzenden Praktiken der Mehrheitsgesellschaft hinaus tragen die Geschlechterbeziehungen innerhalb der Roma-Gemeinschaften zur multiplen Marginalisierung von Roma-Frauen bei. Das patriarchalische Familienmodell der Roma beeinträchtigt den Zugang von Roma-Frauen zu grundlegenden Menschenrechten und setzt sie allen Formen von Gewalt aus. Sie erleben Unterdrückung, wenn Männer die Regeln aufstellen, nach denen Frauen leben müssen. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage in 11 EU-Mitgliedstaaten zeigen die Ergebnisse, dass die Situation von Roma-Frauen in wichtigen Lebensbereichen wie Bildung, Beschäftigung und Gesundheit schlechter ist als die von Roma-Männern. In Bezug auf den Bildungsabschluss geben beispielsweise 23 % der befragten Roma-Frauen an, dass sie weder lesen noch schreiben können, und 19 % sind nie zur Schule gegangen. Ihre Beteiligung an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen (d. h. in Familien, auf Gemeindeebene und in der Politik) ist oft begrenzt. Die sich überschneidenden Aspekte der Marginalisierung von Roma-Frauen wurden weitgehend unbeachtet gelassen. Historisch gesehen wurden die Erkenntnisse, Lehren und Erfahrungen der Roma-Bevölkerung systematisch von zeitgenössischen Bildungseinrichtungen und eurozentrischen Wissenssystemen ausgeschlossen. Sie wurden untersucht, ohne dass ihre eigene Stimme bei der Interpretation ihrer kulturellen Praktiken und ihres sozialen Verhaltens berücksichtigt wurde, was negative Stereotypen verstärkt hat. Interpretationen des Bildes und des Lebens der Roma sind durchdrungen von Fehlwahrnehmungen, Mythen und Annahmen, die auf stereotypen Definitionen beruhen. Darüber hinaus haben akademische Diskurse die Roma-Bevölkerung weitgehend als eine einzige homogene Gruppe behandelt, wodurch die besonderen Erfahrungen, mit denen Roma-Frauen konfrontiert sind, außer Acht gelassen werden. In Deutschland werden 99 % der wissenschaftlichen und fachlichen Arbeiten über Roma von Nicht-Roma-Forschern verfasst. Dadurch entsteht ein Teufelskreis: Indem sie unverändert bleiben, stärken Grundsatzdokumente, Fachartikel und Lehrtexte und Bücher lediglich Vorurteile und bilden künftige Helfer, einschließlich Sozialarbeiter, unangemessen aus – und verstärken einen ungünstigen gesellschaftlichen Diskurs. Dies betrifft insbesondere Roma-Frauen, die häufig als ungebildet, Diebe, exotisch gekleidet und sexualisiert dargestellt werden. Dies trägt zur Entwicklung ihres verzerrten Selbstbildes bei.
Die Strategie
Um den Roma-Frauen Europas die Staatsbürgerschaft zu bringen, organisiert Isidora sorgfältig eine Bewegung: Erstens hat Isidora über viele Jahre mit einer Kerngruppe von Frauen zusammengearbeitet, um diese Bewegung auf die nächste Stufe zu bringen. In dieser Gruppe identifizieren Künstler*innen, Akademiker*innen und Sozialarbeiter*innen mit Sinti- und Roma-Herkunft Bedürfnisse und Möglichkeiten in ihren Arbeitsfeldern und bauen Partnerschaften mit anderen Teammitgliedern auf. Beispielsweise könnten Sozialarbeiter helfen, einen sich abzeichnenden Bedarf von Roma-Kindern zu erkennen, oder Akademiker könnten eine Lücke im System erkennen, wenn es um die Geschichte der Roma und Sinti in Europa geht. Dieses Team ist entscheidend, um die aktuellen Bedürfnisse der Community zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Sobald die Roma-Frauen zusammengebracht sind, entwickeln sie mit Hilfe des Kernteams entweder neue Erzählungen oder Aktionspläne zu ihren Problemen. Wenn eine neue Erzählung (z. B. Roma litten auch unter dem Holocaust) oder eine neue Geschichte (z. B. eine Roma-Frau wird ohne ersichtlichen Grund gefeuert) geteilt werden soll, wendet sich Isidora an ihre Medienpartner, zu denen auch junge Roma-Influencer gehören Social-Media-Enthusiasten und Mainstream-Medienprofis. Beispielsweise hat RomaniPhen mit der Verwaltung von Holocaust-Gedenkstätten zusammengearbeitet, um QR-Codes einzufügen, die die Besucher zu Internetseiten führen würden, die die Roma-Perspektive zum Holocaust bieten. Als die ersten QR-Codes für das Lebende Archiv über den Holocaust in Berlin angebracht wurden, organisierten ihre jungen Freiwilligen eine Social-Media-Kampagne, um anderen zu helfen, diesen neuen Beitrag der Roma-Frauen zur Geschichte zu erkennen. Wenn die Frauen einen Aktionsplan zu ihren spezifischen Themen haben, wendet sich Isidora dann an die Institutionen, sei es die Kommune oder die gemeinnützigen Organisationen. Indem sie Roma-Frauen die Möglichkeit gibt, sich zu Wort zu melden, indem sie in jeder Institution Verbündete findet und den richtigen Ton anschlägt, bereitet Isidora den Raum für die Interessenvertretung von Roma-Frauen vor. Diese Arbeit wird nicht nur in Nicht-Roma-Einrichtungen geleistet; Auch traditionelle patriarchalische Roma-Organisationen werden hierin einbezogen. Um jüngere Generationen mit ähnlichen Werkzeugen auszustatten, hat RomaniPhen eine Initiativgruppe für Mädchen namens Romani Chaji gegründet, in der sie Themen diskutieren können, die ihnen niemand zu Hause oder in der Schule beibringt (z reproduktive Rechte). In wöchentlichen Workshops lernen sie, sich als Gruppe zu organisieren und gestalten und erkunden Möglichkeiten, sich und die Roma-Kultur darzustellen (z. B. durch Podcasts, Theaterstücke, Fotoprojekte, Schulworkshops zum Thema Diskriminierung). Darüber hinaus erfahren diese Mädchen, wenn sie später mit erwachsenen Begünstigten der Organisation zusammenkommen, nicht nur etwas über ihre Geschichte und Identität, sondern treffen auch auf potenzielle Vorbilder und bauen eine Gemeinschaft aktivistischer Verbündeter für die Zukunft als Grundlage für generationsübergreifendes kollektives Handeln auf. Seit 2016 wird der Romnja Power Month (die Flagship-Veranstaltung von RomaniPhen) immer bekannter, die Zahl der Besucher und Kooperationen wächst. Durchschnittlich kommen in Berlin zwischen 20 und 50 Personen zu den 15-18 Veranstaltungen; An der Abschlussveranstaltung nehmen zwischen 150-200 Personen teil. 2020 wurde der Romnja Power Month von anderen Roma-Organisationen in Rumänien und Österreich wiederholt. RomaniPhen führte erstmals die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache für Roma und Sinti (Rom*nja und Sinti*zze) in der deutschen Schrift ein, die inzwischen zur gängigen Praxis geworden ist und in offiziellen Regierungsberichten und anderen Basisorganisationen übernommen wird. Roma-Frauen werden von anderen Organisationen unabhängig von der Vermittlung durch RomaniPhens eingeladen, um zu zeigen, dass ihre Arbeit und ihr Wissen geschätzt werden. Die von RomaniPhen produzierten Materialien und Arbeitsergebnisse werden in Kitas und Schulen, in der Politik sowie in wissenschaftlichen Publikationen und in der Lehre nachgefragt und verwendet. Langfristig zielt Isidora darauf ab, eine europaweite Gemeinschaft von Roma-Frauen zu schaffen, die eine neue Erzählung über sich selbst zusammenweben können. Der RomnjaPower Month wurde 2016 von RomaniPhen ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr als landesweite Veranstaltung statt. 2019, kurz vor Ausbruch der Pandemie, wurde es erstmals von anderen europäischen selbstorganisierten Gruppen von Roma-Frauen aufgegriffen. Isidora stellt sich vor, dass es in ganz Europa institutionalisiert wird, um kollektive Macht über Grenzen hinweg aufzubauen. Ein weiteres Ziel des Teams ist es, in den folgenden Jahren enge Gespräche mit Universitäten, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Stellen zu pflegen und auszubauen. Aufbauend auf ihrer eigenen Erfahrung beim Aufbau der ersten von Roma-Frauen geführten Organisation in Deutschland arbeitet Isidora nun mit anderen Organisationen und Netzwerken zusammen, die marginalisierte Bevölkerungsgruppen vertreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Roma-Organisationen (z. B. die Initiative für Schwarze Menschen in Deutschland). Durch die Bereitstellung von Toolkits und Blaupausen zum Aufbau und Management von selbstorganisierten Strukturen und Netzwerken in der Gemeinschaft möchte sie es ihnen ermöglichen, ihre eigenen von der Gemeinschaft geführten Antworten auf ihre Ausgrenzung und falsche Darstellung zu entwickeln.